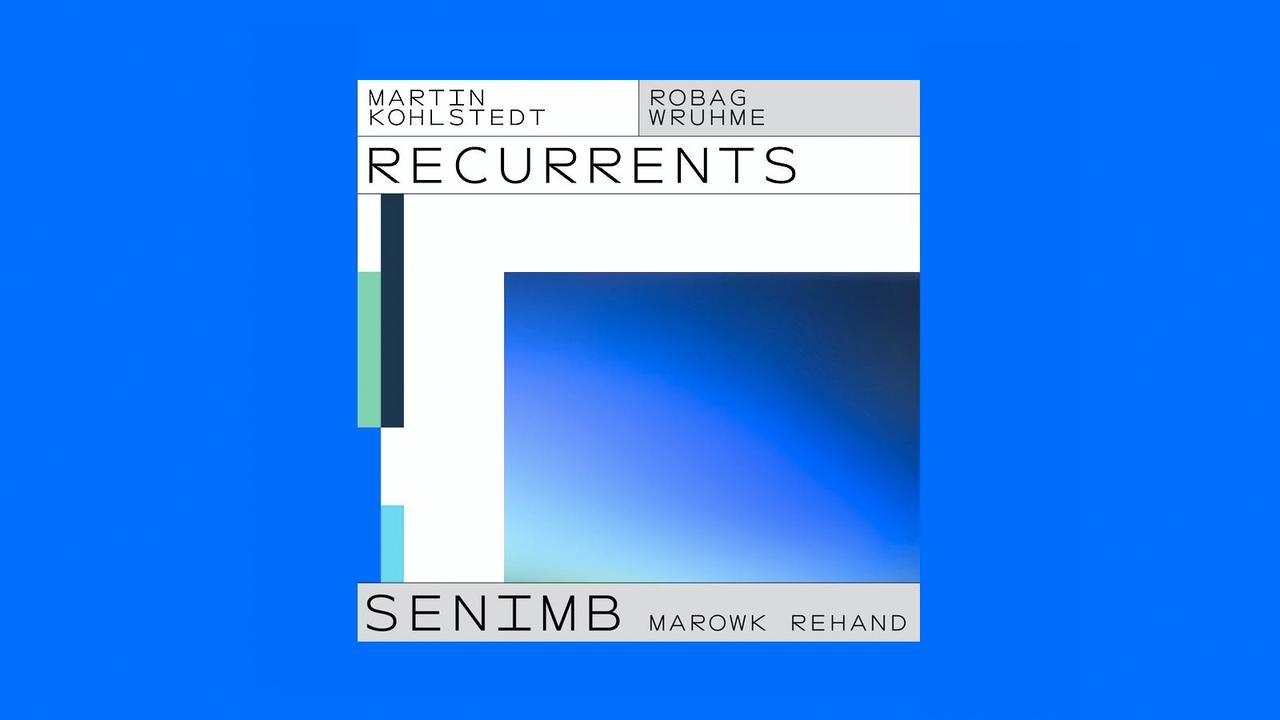Wir bleiben zu Hause, wir gucken Heimkino: Empfehlungen unseres Filmautors Sulgi Lie für die Wohnzimmerleinwand. Heute: „Inception“ von Christopher Nolan. Wohl kein Film hat seit 2010 eine Tiefenbohrung in dieser Dimension vorgenommen. Dabei baute Christopher Nolan auf ein altes Kinoschema, nämlich den Zusammenfall der psychischen Realität des Traums und der physischen Wirklichkeit. Die Psycho-Physik des Kinos als Wunsch- und Traummaschine wurde lange nicht so kraftvoll ausgeleuchtet. Eine Analyse.
Was dem hochtechnologisierten Hollywood-Blockbuster dieser Tage oftmals abgeht, ist eine Qualität, die für gute elektronische Musik essentiell scheint: Deepness. Damit ist nicht nur eine emotionale Tiefe des erzählten Inhalts gemeint, sondern auch eine spezifische Gravität der Audiovision, die sich im Vakuum des computergenerierten Spektakel-Kinos vollends verflüchtigt hat. Schaut man auf die schlechteren Beispiele des Blockbuster-Jahres 2010 wie A-Team und Iron Man 2 zurück, springt einem neben der unangenehmen Mischung aus Infantilität und Militarismus auch die Unfähigkeit dieser Filme ins Auge, überhaupt einen sinnvollen Action-Raum zu entwerfen, der in irgendeiner Weise deeper als die Spieloberfläche von Ballerspielen ist. Wenn es im aktuellen Blockbuster-Kino einen Regisseur gibt, der diesen Regressionstendenzen widersteht, dann ist es Christopher Nolan. Nolan ist der Mann für filmische Tiefenbohrungen, die auch über den unmittelbaren Konsum hinaus in den Magen- und Gehirnwindungen des Zuschauers ihre Spuren hinterlassen. Schon in The Dark Knight hatten die Action-Szenen eine seltene physische Wucht, die – egal, ob nun analog oder digital fabriziert – dem tiefen Ernst dieser Rechtserzählung nur angemessen war: Denn im Grunde genommen war The Dark Knight ein Spätwestern im Fledermausgewand, eine Parabel über das Verhältnis von Gewalt und Gerechtigkeit, die nicht zufällig in seiner Schlussszene direkt auf den berühmten Slogan von John Fords Western The Man Who Shot Liberty Valance Bezug nimmt: „When the fact becomes legend, print the legend!“
Eine Fiktion, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss, aber dennoch realitätsbegründend ist: Um nichts anderes dreht sich Nolans Inception, sicherlich einer der Meilensteine des jüngeren Hollywood-Kinos, ein Meta-Blockbuster über das Kino als Traummaschine, in der wir eben manchmal nie wieder erwachen wollen, weil die Realität des Traums uns realer erscheint als die Wirklichkeit. In diesem Sinne nimmt die verschlungene Plot- und Traumkonstruktion von Inception einen Grundsatz der (Freudianischen) Psychoanalyse durchaus ernst: dass nämlich die psychische Realität des Traums für das Unbewusste des Träumers genauso „real“ ist wie die physische Wirklichkeit.
Traum als Architektur
Deshalb ist es nur konsequent, dass Nolan die verschiedenen Traum-Levels des Films gerade nicht in ihrer Irrealität markiert, sondern ihre materiale Objektivität und Objekthaftigkeit ausstellt: In Inception ist die Traumwelt ganz Architektur. Bis auf ein, zwei kurze Szenen, wie die Zusammenfaltung von Paris, verzichtet Nolan fast gänzlich auf die digitale Morphbarkeit von Räumen und setzt auf die realistische Schwerkraft der architektonischen Bauten. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Träumenden, in deren Innerstes Dom Cobb (Leonardo di Caprio) und seine Dream-Caper-Team eindringen, um ihnen fremde Gedanken einzupflanzen, vergessen sollen, dass sie überhaupt träumen. Nur in der Deep Immersion des Träumers in seinen Traum kann die titelgebende Inception die Psyche des Träumers neu programmieren.
Inception ist Deception: der Traum im Traum im Traum im Traum.
Für diese psychische Tiefenbohrung schart Cobb nur die besten Illusionisten um sich: Die Traumarchitektin, der Gestalt-Switcher, der Pharmazeut, sie alle sind Klarträumer, die im Gegensatz zum Opfer bewusst in das Traumgeschehen eingreifen können. Doch nach und nach wird dieser Unterschied zwischen aktiven Traummanipulatoren und passiven Traumopfern ebenso unterlaufen wie die Grenze zwischen fremder und eigener Psyche: Das Ich ist nicht länger Herr im eigenen Haus, denn in den Traum mischt sich immer mehr das Trauma. Immer unkontrollierbarer schwirren die sogenannten Projektionen von Cobbs verstorbener Frau Mal als Fremdkörper in die generalstabsmäßig geplante Logistik der Inception, die den Sohn eines verstorbenen Magnaten zur Auflösung seines Firmenimperiums bewegen soll. Obwohl in der tiefsten Schicht des Traums auch bei Nolan ödipale Konflikte und das Rätsel der Geschlechterdifferenz regieren, ist Inception doch in keiner Weise einem apolitischen Familialismus verpflichtet. In virtuoser Weise laviert der Film zwischen der Innenschau der privaten Psychobiographie und einer gleichsam globalen Totalen, in der Traumextraktionen und Inzeptionen zunächst nichts anderes sind als raffinierte Mittel des kapitalistischen Konkurrenzkampfs. Geht der Auftrag zur Inception doch von einem japanischen Investor aus, der sein Konkurrenzunternehmen ausgeschaltet wissen will.
Nolan variiert hier einmal mehr ein Motiv, das bereits seinen Zauberer-Film The Prestige umtreibt: Wie kann ich meinen Konkurrenten vernichten? Auch in The Prestige entscheidet sich diese Frage auf dem Kampfplatz der Illusionen: trick your enemy. In Inception ist diese Konkurrenz nun auf allen Ebenen total geworden: Wenn der Film rastlos zwischen allen fünf Kontinenten, zwischen Kyoto, Paris, Sydney, Marrakesch, Kinshasa, New York und Los Angeles hin- und herwechselt, hat dies nur bedingt etwas mit einer touristischen Attraktionsgier à la James Bond zu tun, sondern vielmehr mit der permanenten Vermittlung von Makro- und Mikroebene: den Traum zu einer Welt zu machen, heißt auch, eine ganze Geopolitik in diesen einzuführen. Eine Geopolitik, die zugleich eine Biopolitik sowie eine Psychopolitik ist.
Figuren des Fallens
Was Inception auch in seiner extrem trügerischen Schließung vorführt, ist die Unmöglichkeit, die klassische kleinfamiliäre Ideologie überhaupt noch darstellen zu können. Von Bildern romantischer Paarbildung kann er allenfalls im Modus einer fast schon psychotischen Stillstellung erzählen, wenn sich Cobb und seine Frau in der postapokalyptischen Zeitlosigkeit ihrer Träume einschließen. An Spielbergs Artificial Intelligence gemahnend, inszeniert Nolan diese Bilder so, als wären die Beiden das letzte Paar nach dem Ende der Welt. Keine utopische, vielmehr eine dystopische Vision einer nachhumanen Science-Fiction, die ihre Entsprechung in der Eislandschaft hat, in der Robert Fischer (Cillian Murphy) auf seinen sterbenden Vater trifft: Als würde es sich auch hier um die letzte Vater-Sohn-Begegnung der Welt handeln, versetzt Nolan das paternale Totenbett in einen hypersterilen Raum, der direkt aus Kubricks 2001 stammen könnte.
Inception ist nicht nur in architektonischer Hinsicht Kubrick zutiefst verpflichtet. Der Film stellt auch Kubricks zentrale Frage: Ist der Mensch überhaupt noch als Mensch darstellbar?
Überhaupt ist Inception nicht nur in architektonischer Hinsicht (die Raumtiefe der Hotelkorridore!) Kubrick zutiefst verpflichtet; er laboriert an einer Frage, die für Kubricks Werk absolut zentral ist – ob der Mensch überhaupt noch als Mensch darstellbar ist. Gerade in den Zerrbildern privater Intimität stößt Inception zu einer Schicht vor, in der eben der Traum nicht mehr von der Lebendigkeit des Subjekts zeugt, das nunmehr im Limbus einer untoten Existenz fristet. Das ist die Negativität, die trotz all der furiosen Action, den Film bis in die kleinsten formalen Details prägt: Obsessiv kreist der Film um Figuren des Fallens, des Stürzens ins Bodenlose. Der Fall der Körper, der Sog der Schwerkraft, der beim Aufprall zum Erwachen führen, aber auch ins Endlose zerdehnt werden kann. Eingerahmt in eine der längsten Zeitlupen der Filmgeschichte, zieht Nolan im finalen Traumdelirium zwischen Fallen und Schweben, zwischen der Endlichkeit des Moments und der Unendlichkeit der Zeit alle Register. Indem er die unterschiedlichen Raum- und Zeitebenen der Traumlevels wie tektonische Schichten ineinander schiebt, verhilft er einem fast schon altmodischen filmischen Verfahren zu seinem Recht: der Parallelmontage. Wiederum verneigt sich Nolan vor den großen Onirikern des Kinos, die zugleich alle große Architekten des Unbewussten waren: Nicht nur Kubrick, sondern auch Hitchcock und De Palma. Die Ultrazeitlupe ist De Palma entlehnt, die Schlittenfahrt im endlosen Schnee lässt an das Ursprungstrauma von Hitchcocks Spellbound denken.
Deepe Bass-Drones
Inception wäre aber nicht der große Film, der er ist, ohne den gigantischen Soundtrack von Hans Zimmer: Ausgerechnet Hans Zimmer, von Kritikern oftmals als kommerzieller Bad Boy verachtet, hat hier zweifellos den Score seines Lebens geschrieben. Fast ohne Unterbrechung treiben dunkle Strings und Basstöne den Film in ein fortwährendes Crescendo, das schließlich bei der Zeitlupe des LKWs kurz vor den Aufprall in eine Repetition unfassbar deeper Bass-Drones mündet, die den Zuschauern in Haut und Haare fahren. Die Psycho-Physik des Kinos als Wunsch- und Traummaschine, die „Inception“ wie kein anderer Film entfesselt, steht und fällt mit dieser Musik, die einem schier den Verstand raubt. Gilles Deleuze hat einmal geschrieben: „Wenn du im Traum eines anderen gefangen bist, bist du verloren.“ Inception wagt diesen Fall into the Deep.
Inception ist bei Warner Bros erschienen. Dieser Text wurde zuerst in De:Bug Ausgabe 148 veröffentlicht.