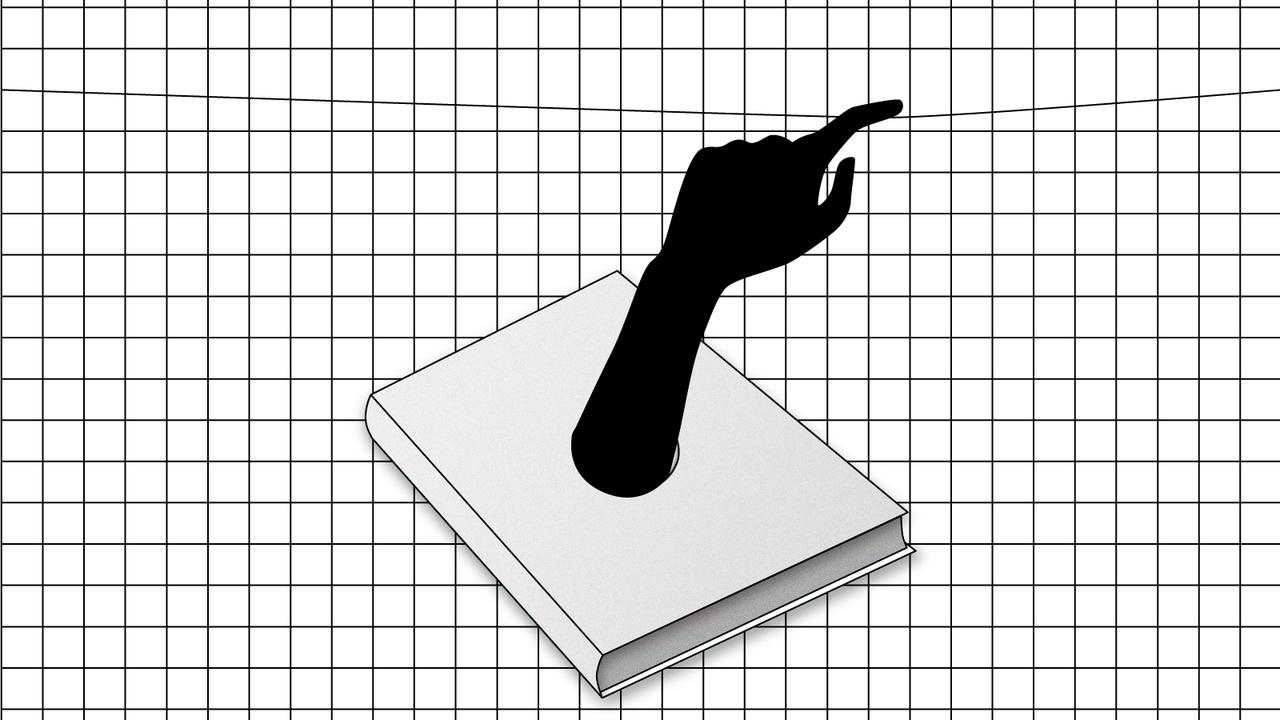Bild: giphy.com
Drei Alben, drei Tipps, drei Meinungen. In unserer samstäglichen Filter-Kolumne wirft die Redaktion Musik in die Runde, die erwähnenswert ist. Weil sie neu ist, plötzlich wieder relevant, gerade entdeckt oder nie vergessen. Und im Zweifelsfall einfach ein kurzweiliger Zeitvertreib ist.
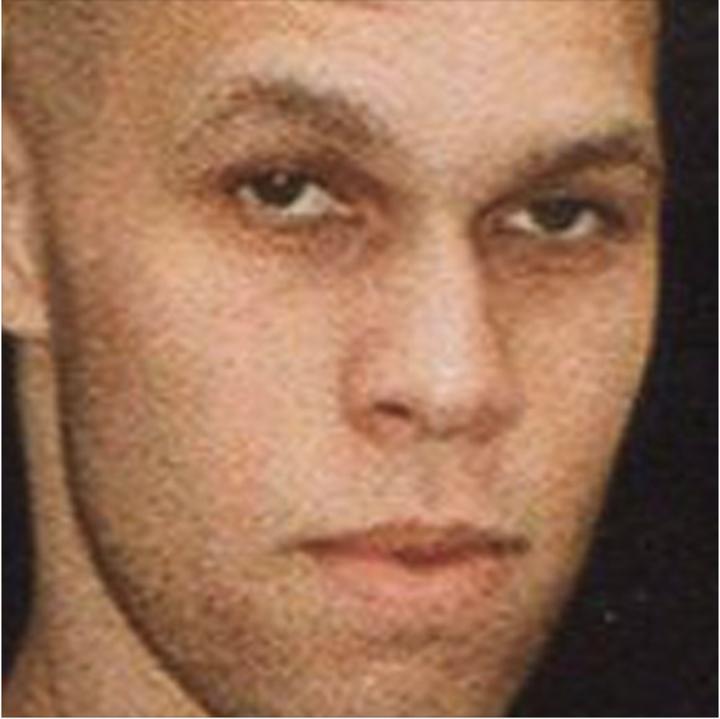
##Delroy Edwards – Hangin’ At the Beach
Susann: Ich habe eine große Schwäche für Lo-Fi-Sounds, ob im Punk, Indie oder Techno. Dabei ist die Gratwanderung zwischen zu gewollter Retro-Ästhetik und einem guten, rauen Sound, der auch noch nach 2016 klingt, selten zu meistern. Einen ganz frischen Release und bemerkenswerten Anlauf in diesem Metier gibt es von der amerikanischen Westküste. Delroy Edwards, bürgerlich Brandon Perlman, veröffentlicht auf seinem eigenem Label L.A. Club Resource „Hangin’ At the Beach” und liefert damit auch gleich den Soundtrack zum jüngsten Stranger Things-Hype. Gleich auf 30 Tracks – jedoch größtenteils in Punkrocksonglängen von < 2 Minuten – hört man Edwards Vorlieben für Noise-Rap, Hardcore Punk und 80ies-Synth-Sounds deutlich. Das ist vermutlich auch die augenfälligste Gemeinsamkeit zu Stranger Things: „Hangin’ At the Beach” und die Netflix-Serie stellen ihre Zitate so offen zur Schau, dass es kein postmodern-ironisches Retro-Augenzwinkern mehr gibt. Man kann das für Kalkül halten, derart an nostalgische Vorlieben zu appellieren oder sich freuen, dass es solche Musikbegeisterte da draußen gibt, die mit einer guten Spürnase alte Platten diggen und daraus einen angenehm-düsteren Sommer-Soundtrack schaffen. Da ist es auch nur konsequent, dass Delroy Edwards in seinem Store neben dem eigenen Album und Merchandise auch Oldschool-Kassetten vertreibt.
Album bei iTunes

Leon Vynehall – Rojus (Designed to Dance)
Benedikt: Wenn im Untertitel „Designed to Dance“ steht, wie sieht dann wohl der Club aus, den man betritt, um sich zu Vynehalls Album zu bewegen? Ziemlich gemütlich auf jeden Fall. Wände aus Holz lassen die Basslines noch wärmer und runder klingen, als sie eh schon sind. Die Einrichtung: zusammengewürfelt, aber dennoch einem schlichten Stil folgend – wahrscheinlich Rentnerhaushaltsauflösung. Die Tanzfläche ist kleiner als das heimische Wohnzimmer, die Atmosphäre intim. Die Crowd bewegt sich eher gediegen: keiner schlägt über die Stränge, aber es steht auch niemand wirklich still. Die Kollegen Thaddeus Hermann und Ji-Hun stehen am Rand, wippen im Takt und fragen sich ob der gerade laufende Track wohl von George FitzGerald oder Mano Le Tough ist. Liegen beide falsch. An der Bar sitzen Nano Nansen und Max Graef und lachen sich über Glenn Astros Teenie-Mixtape kaputt. Redakteurskollege Jan-Peter ist ziemlich angetan vom GinTonic, doch das sieht nur, wer sein süffisantes Lächeln deuten kann. Schlechte Spirituosen gibt's hier nicht, man ist schließlich keine 20 mehr, die Preise sind aber trotzdem human, denn Rockefeller ist hier auch niemand. Die Drinks werden schlicht aber stilvoll und versiert serviert – britisches Understatement. Die Atmosphäre ist gleich Wohnzimmer. Keine dunklen Ecken, hinter denen man nicht weiß, was einen erwartet. Keine zweiter Floor auf dem es härter brettert. Und wenn man ehrlich ist, sind auch kaum unbekannte Gesichter zu sehen, nur die Zusammensetzung der Leute erscheint neu. Hier geht man nicht hin um durchzudrehen, dafür aber umso öfter auf ein Feierabendbier zu guter Musik. Auf einmal geht die Tür auf, ein Typ mit langen, blonden Haaren und UK-Akzent steckt seinen Kopf durch: „Brought my new house record from the island. Want to listen?“
Album bei iTunes

##Okamotonoriaki – Happy Ending
Thaddeus: Seit Isan ihr neues Album angekündigt haben, ertappe ich mich dabei, dass ich mich vermehrt durch die historischen Berge von Elektronika-infiziertem Plinker- und Knurschpel-Pop höre und dabei ein kleines bisschen sentimental werde. Dabei muss ich gar nicht Backup-Festplatten aus der Schublade oder 7“-Boxen aus dem Regal holen: okamotonoriaki verfolgt diesen Sound noch heute, als Archivarius der leisen Töne, mit japanischer Note. Denn okamotonoriaki kommt aus Tokio. Elektronika, made in Japan, war mal eine große Nummer. Unglaublich cute, vor allem aber sehr schwerelos und – hier wird es besonders – mit viel mehr akustischen Versatzstücken als die europäischen Entwürfe. Irgendwann waren die Tricks und Kniffe dann aber über alle Maße durchdekliniert und der überbordende Einsatz der Melodica begann zu nerven. Mich zumindest. Das Gleiche galt für ebenso cuten Vocals von Sängerinnen, die gar nicht besonders gut singen konnten, und aus dem Hauchen eine Tugend machten. All das gibt es bei okamotonoriaki auch. Wieder. Immer noch. „Happy Ending“ ist dennoch eine tolle Platte geworden, ein Anknüpfungspunkt an alte Zeiten, in denen sich die Popmusik veränderte und um eine Variante reicher wurde. Das Album mischt die kleinen Beats mit den noch kleineren Melodien, das Hauchen ist wieder da (wenn auch – zum Glück – nicht auf allen Tracks), ein paar wenige Samples orchestrieren einen Sound voll hell klingender Glöcken, großer Momente („Polaris“) und bei aller Bescheidenheit wirklich herzzerreißender Schönheit („Tokyo“). Das Elektronika-Rad läuft immer noch so geschmiert, dass man es gar nicht neu erfinden muss.
Album bei iTunes