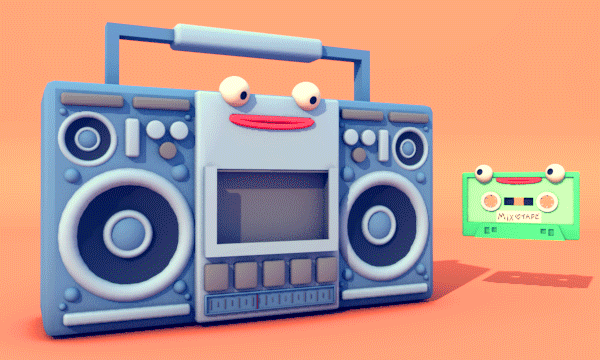
Drei Alben, drei Tipps, drei Meinungen. In unserer samstäglichen Filter-Kolumne wirft die Redaktion Musik in die Runde, die erwähnenswert ist. Weil sie neu ist, plötzlich wieder relevant, gerade entdeckt oder nie vergessen. Und im Zweifelsfall einfach ein kurzweiliger Zeitvertreib ist.

##Crack Ignaz & Wandl – Geld Leben
Christian: Letzte Woche, morgens, Radiowecker, noch im Halbschlaf, Deutschlandradio gehört. Da wurde ein Beitrag unter Nennung der Autorin abmoderiert, sie hieß glaube ich Sabine Kusch. Da musste ich dann kichern und war sofort wach. Wegen "Kush", höhö. Vielleicht höre ich in letzter Zeit zu viel Rap? Möglich. Vielleicht ist es ja auch Zeit hier mal über diese Sache zu sprechen, über diese doch noch recht neue Sprache im deutschen HipHop, über Cloudrap, den sogenannten, über die Adaption von Chicago Drill oder Trap oder wie auch immer man das nun nennen soll / will / kann. Wo die HiHat der 808 durchrollt und das Kush immer lila ist. Sie wissen schon: der inzwischen bis zur Contemporary Art verklärte Yung Hurn („Nein!“), die über-smarte Haiyti („Null-Acht-Fuffi“) oder aber das Babyface LGoony, der Lines droppt wie: „Baddest Motherfucker, ich seh’ aus wie vierzehn / Vierzehn mal mehr Swag als Du und das mit Vierzehn!“ Allesamt Künstler, die in selbstgedrehten iPhone-Videos davon erzählen, wie sie das Cash aus den Fenstern ihrer Maseratis werfen. Die ihre Free-Mixtapes raushauen, wie die anderen das, angefangen beim schwedischen „Sad Boy“-Yung Lean bis hin zu „Post-Language“-Young Thug, ja auch alle tun. Allesamt Künstler, die die mitunter nervigen Authentizitäts-Logiken von Rap (Straße) auf den Kopf stellen, aber ihre maßlosen Übertreibungen trotzdem nicht satirisch meinen („120 Tausend Milliarden, alles echt“). Und die oft Kopfschütteln ernten, wie etwa vom deutschen HipHop-Paten Marcus Staiger persönlich, der bekundete, er könne diese Musik nicht fühlen – der aber sehr paternalistisch hinzufügte, er müsse das auch gar nicht, denn er sei schließlich dieser ProtagonistInnen Vater. An anderer Stelle gibt es auch das große Abfeiern, was sich oft wie ein journalistisches Ranschmeißen anhört, etwa wenn der Vice-Kanal Noisey Headlines raushaut wie „XY hat gerade deutschen Rap zerfickt!“ Ach Gott, ja. Wenn man übrigens mal die YouTube-Kommentare unter den Videos der entsprechenden KünstlerInnen liest (man sollte das nicht tun, i know), scheint es für die genannten Artists eh nichts zwischen Hass oder Liebe zu geben. Solches Polarisieren ist natürlich Blödsinn. Den vielleicht einleuchtendsten Beweis, dass diese Musik einfach eine Spielform von HipHop ist (und nicht etwa dessen Gegenteil respektive Ende respektive Zukunft) hat der Salzburger Crack Ignaz schon vor einigen Monaten geliefert. Und zwar mit einer (von mir erst jetzt entdeckten) Platte, die den sehr großartigen Titel „Geld Leben“ trägt. „Geld Leben“ vermählt Chicago Drill mit konservativem Boombap-Rap, es ist musikalisch wie textlich frisch und gleichzeitig geschichtsbewusst. Dementsprechend ambivalent ist das gezeichnete Selbstporträt: In einem Song hat Ignaz für „Message-Rapper nur Messerstecher“ parat, im nächsten ist der Gangster-Modus wieder passé und Ignaz ist der liebste „Pretty Boy“, der sich „Wan-Tan-Nudos mit Sugo“ in die Bude bestellt, weil er sich nach zu viel „Lila Weed“ hinterm Pluto wähnt. Die Beats und Samples (produziert von Wandl) sind allesamt großartig und ja, ab einem gewissen Alter wird HörerIn sicher Lust mitbringen müssen, die mehr als „uneigentliche Sprache“ zu decodieren – oder wenigstens die Salzburger Mundart. Was man aber ziemlich schnell versteht ist, dass Ignaz selbst dann noch Gucci ist, wenn er nur am fooden ist. Swah!
Album bei iTunes

##Thomas Bachner – Human Too
Thaddeus: Es gibt ja Platten – Schallplatten –, die kauft man voller Begeisterung im Laden, trägt sie stolz nach Hause, spielt sie ein paar Tage lang immer und immer wieder, platziert sie dann auf dem „wichtigen“ Stapel und schwupps: Aus dem Auge aus dem Sinn. Genau so ging es mir mit diesem Album von Thomas Bachner und einigen anderen Veröffentlichungen auf Playtracks. Kürzlich dann entdeckte ich eine 10“ von „Jazzmoon“ (auch Thomas Bachner) unter meinem Plattenspieler (fragt besser nichts) und die Begeisterung kehrte zurück. Da war doch noch was, dachte ich, und fand dieses Album hier schließlich wieder. Im „wichtigen“ Stapel, der mittlerweile nur nicht mehr so wichtig schien: Da stapelten sich mitunter komische Dinge. Dieses Album also changiert derart perfekt zwischen ambienter Kratzbürstigkeit, Move-D-inspiriertem Groovebox-Jazz und quergedachtem Garten-House, dass ich es wieder für ein paar Tage lang konsequent auflegte und sanft über das Laminat steppte. Und versuchte, Kontakt zu Herrn Bachner aufzunehmen, denn das Album gab es nicht digital und das war Scheiße, denn mein Telefon liebt Garten-House und ambiente Kratzbürstigkeit. Move D und Groovebox-Jazz sowieso. Eine E-Mail ins Nichts und rund eine Woche später schließlich die Antwort: Ja, das Digitale habe er jetzt dann doch mal gemacht. Danke dafür. „Human Too“ war die letzte Veröffentlichung auf Playtracks. 2012. Bis zum heutigen Tag. Man soll ja nie nie sagen. Wenn die Geschichte von Thomas Bachner und Playtracks irgendwann weitergehen sollte, bekomme ich hoffentlich eine zweite E-Mail.
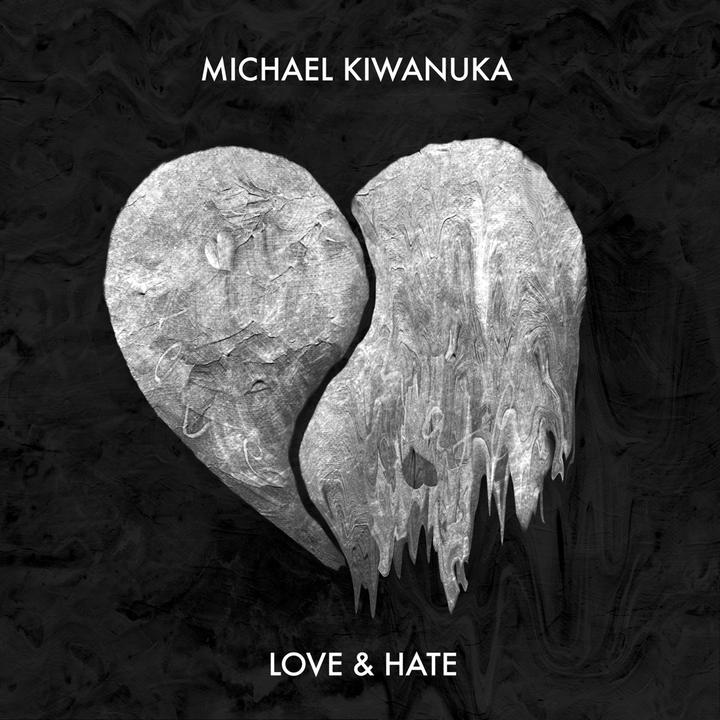
Michael Kiwanuka – Love & Hate
Benedikt: Vier Jahre sind seit seinem Debütalbum „Home Again“ vergangen. Vier Jahre seit den großen Vergleichen, vor denen auch Kollege Ji-Hun keine Scheu hatte: Curtis Mayfield, Al Green bei anderen auch Marvin Gaye oder Bill Withers. Konnte der Druck, der da auf dem zweiten Album lastete überhaupt größer sein? Spielt jetzt keine Rolle mehr, das Album ist raus und wird jeder Nuance seiner Erwartungen gerecht. Kein Hauch von Kopie, „Love & Hate“ ist wie eine charakterliche Weiterentwicklung, um die Erfahrungen von vier Jahren reicher: gefestigt und weniger schüchtern, voll von Orchesterklängen, Chorgesängen und mehr Folk und Funk. Aber immer noch Soul bis in die letzten Takt. Gleiches gilt inhaltlich. „I’m a black man in a white world“ stellt der 29-Jährige, begleitet von Gospelchor und Clap-Percussion fest. Da schwingt aber kaum Groll mit, vielmehr Traurigkeit und fast schon Resignation. Das „You can't break me down / You can't take me down“ in „Love & Hate“ ist nur ein kurzes, selbstbewusstes Aufbäumen während einer einsamen Suche nach Fixpunkten im Leben, in der Welt. Dieses kurze Aufbäumen gibt es immer wieder, täuscht aber nicht darüber hinweg, das Kiwanuka ein ständiger Zweifler ist, ein Allesinfragesteller. „Love & Hate“ nimmt einen mit, ohne zu zermürben, was auch an der großartigen Produktion von Danger Mouse liegt. Allein der Opener „Cold Little Heart“, imposant und episch wie ein Track von Pink Floyd – inklusive der Gitarre. Die Welt hat dieses Album gebraucht.
Album bei iTunes











