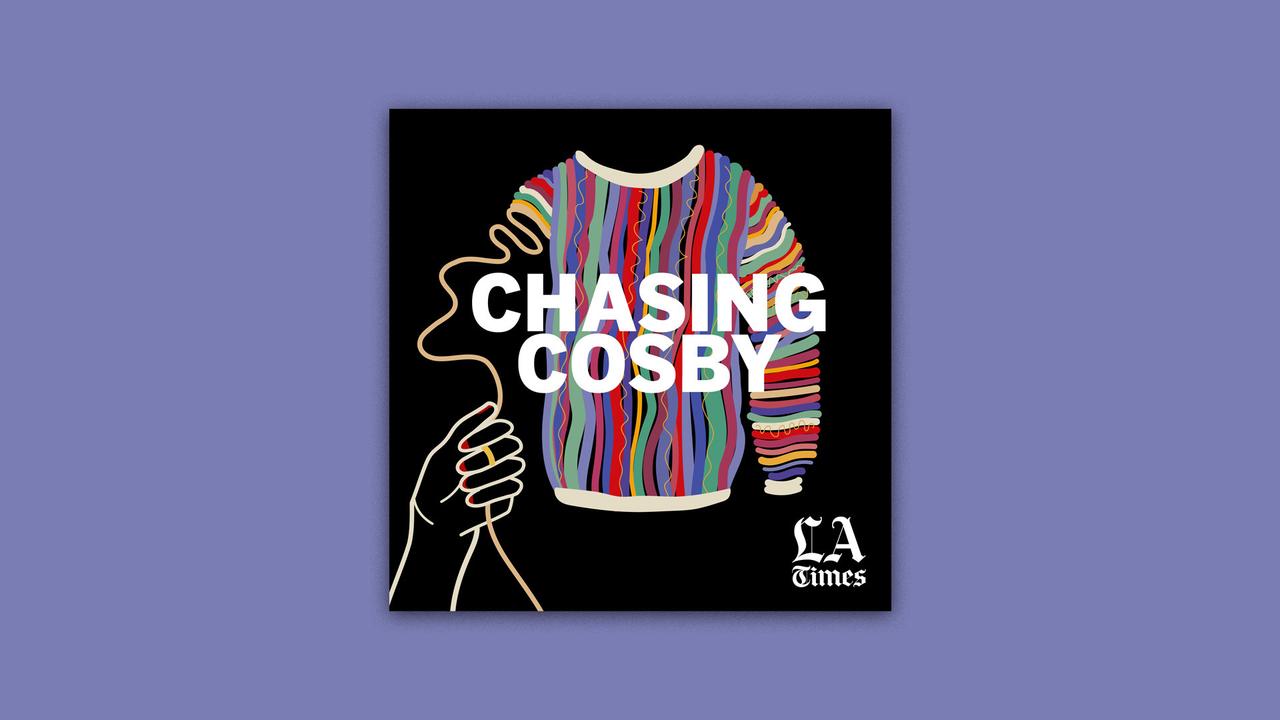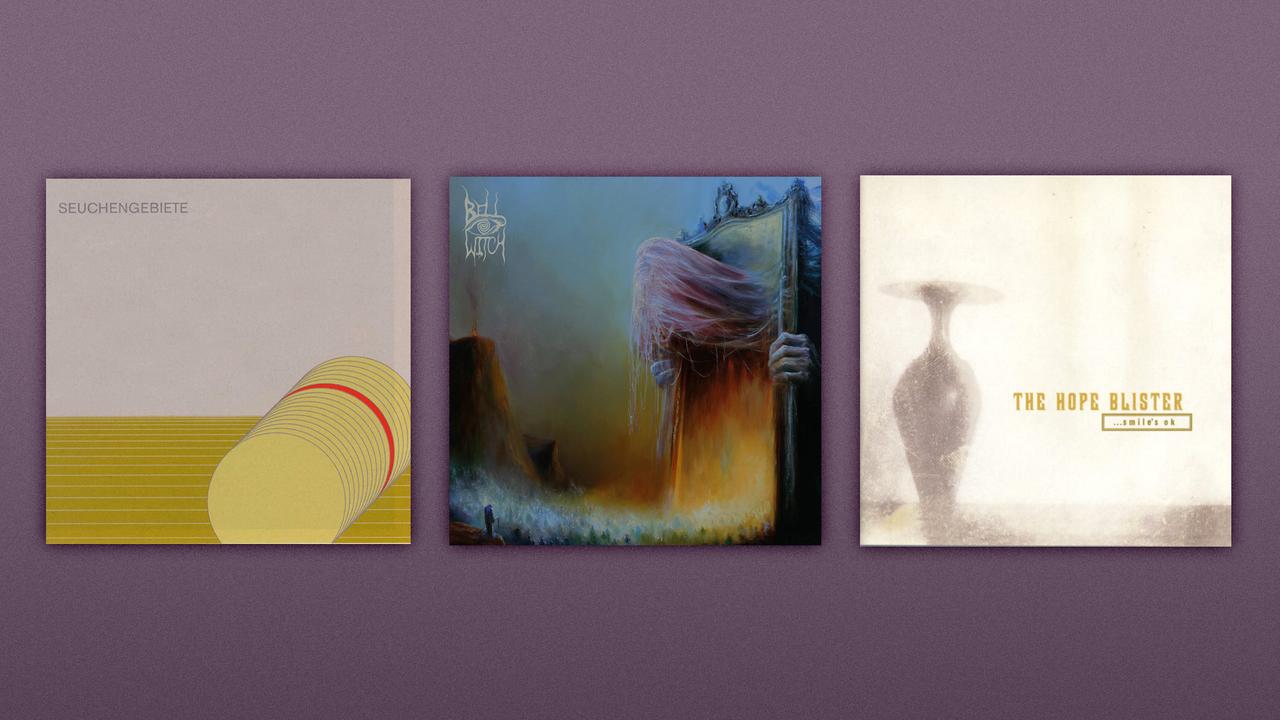Wir bleiben zu Hause, wir gucken Heimkino: Empfehlungen unseres Filmautors Sulgi Lie für die Wohnzimmerleinwand. Heute zieht er sich Tanzschuhe und Schlaghosen an, hängt die Spiegelkugel auf, denn es geht um Saturday Night Fever (1978). John Travolta hat den ganzen Weg beschritten, von Disco als kollektivem Befreiungsschlag über die „Fit for Fun“-Pervertierung bis zum einsamen Totentanz. Seine Filme zeichnen anschaulich den soziokulturellen Niedergang der Discokultur nach. Aber wir stehen bereit, um den Hustle wieder zu lernen.
Disco ist tot, lang lebe Disco: Kokain sei „dead as disco“, so erklärte der von Eric Stoltz gespielte Dealer noch John Travolta in Tarantinos Pulp Fiction, denn der Siegeszug von Heroin sei eine längst vollzogene Tatsache. Daraufhin setzt sich Travolta einen Schuss mit High-Quality-Heroin aus dem deutschen Erzgebirge, um anschließend den berühmt gewordenen Tanz mit Uma Thurman zu tanzen. Auch wenn die große Zeit von Disco in den 90ern endgültig vorbei zu sein scheint, gestalten sich die Dinge in Tarantinos popkultureller Geschichtsschreibung allemal vertrackter: Kann Disco jemals ganz tot sein, wenn Travolta noch lebt und gar noch tanzt? In der Gestalt des verfetteten und benebelten Vincent Vega reanimiert Pulp Fiction den Disco-King aus Saturday Night Fever nach dem historischen Ende von Disco. So geraten in dem Twist-Dance zu „You never can tell“ die popkulturellen Zeiten endgültig durcheinander: Die filmische Gegenwart der 90er, das Interieur der 50er, der Chuck-Berry-Song der frühen 60er – das alles wird durch die heroinbedingt entschleunigten Disco-Gesten von Travolta zu einer gebrochenen Reminiszenz an Tony Manero aus Saturday Night Fever. In diesem Sinne ist Travoltas Reenactment seiner früheren Rolle mehr als nur ein nostalgisches Zitat, denn was Tarantino in der Szene vorführt, ist eben auch die historische Kluft zwischen den zwei Körpern von Travolta: Nicht nur hat er die falsche Droge intus, auch der jugendschöne Körper von einst ist endgültig dahin. Und nicht zuletzt wird er die Traumfrau, die er mit seinem Tanz umwirbt, eben nicht mehr kriegen. Der Disco-King bleibt einsam.
Wie vielleicht kein anderer Film macht Pulp Fiction deutlich, dass die maximale Verfügbarkeit über die vergangene Pop-Geschichte für die postmodernen Subjekte keinen gemeinschaftlichen Raum mehr bereitstellt. Die popkulturelle Ausdifferenzierung entkollektiviert zugleich das Genießen. Der historische Abstand zwischen Pulp Fiction und Saturday Night Fever bemisst sich also nicht zuletzt an der Entkoppelung von Pop und Community – eine Discommunity, die im alten Film noch intakt war. Denn wie Tom Holert mal ganz richtig beschrieben hat, war Disco „nicht nur eine Sorte Musik, sondern ein soziales Prinzip; nicht nur eine hedonistische Praxis, sondern genauso eine disziplinäre Ordnung“.
Was Saturday Night Fever von späteren Party-Filmen unterscheidet, ist genau diese Verbindung von Disco und Disziplin. Das Fieber der Nacht basiert hier auf harter Arbeit.
Von der ärmlichen Brooklyner Neighborhood Tony Maneros ist die Studio 54-Dekadenz des Manhattaner Nachtlebens weit entfernt. Für Manero ist Disco Ausdruck seines proletarischen Stolzes: Während sich seine Kumpels nur zudröhnen und Frauen aufreißen wollen, setzt er auf strenges Training und sexuelle Enthaltsamkeit. So sind auch die Rhythmen des Dancefloors in dem Film von den Arbeitsroutinen der fordistischen Disziplin eingetaktet. Manero tanzt nicht nur für sich allein, sondern gliedert seine Mittänzer in den gemeinsamen „Hustle“ ein, in dem sich die Körper zu einem großen Ornament formen.
Disco als kollektives Ordnungsprinzip: Davon scheinen die autistisch vor sich hin tanzenden heutigen Raver doch sehr weit entfernt. In Saturday Night Fever gehen Exzess und Askese Hand in Hand. Die Disco-Utopie, die der Film entwirft, entsteht in diesem Umschlagspunkt von Disziplin in Freiheit, wenn die Eleganz des tanzenden Körpers die dahinter steckende Arbeit vergessen macht. Auch nach über 40 Jahren sind die Tanzsequenzen des Films berauschend schön. Zu den ätherischen Stimmen der Bee Gees tanzt sich Travolta in einen Disco-Himmel, der von den Beschränkungen der Physis befreit scheint. Die glitzernden Tanzbodenlichter verwandeln die Disco in eine schwerelose Sphäre, einen reinen Licht- und Farbraum. Saturday Night Fever feiert Disco gleichsam im Zustand seiner poetischen Unschuld, die bereits in Sylvester Stallones grottigem Sequel Staying Alive (1983) unwiederbringlich dahin ist. Was einst Disco war, heißt in den hässlichen 80ern nun Aerobic und Musical. Aus der fordistischen Körperkontrolle ist „fit for fun“ geworden. Vorbei ist es nun mit dem femininen Glamour des Discodancings, das nun von einem martialischen Tanzstil ersetzt worden ist, der eher wie ein schweißtreibendes Work-Out anmutet. Der Tiefpunkt ist endgültig erreicht, wenn sich Travolta im Finale des Films im knapp beschürzten Ethno-Outfit durch eine grausame Musical-Choreographie turnt, die auch in den an Geschmacklosigkeit nicht gerade armen Achtzigernjahren ihresgleichen sucht.
Dem einen Disco, dem anderen Porno
Dass mit diesem Film auch Travoltas Filmkarriere bis Pulp Fiction quasi beendet war, kann im Kontext von Disco als symptomatisch gelten. Aus der filmischen Perspektive des Disco-Revivals der 90er Jahre erscheinen die 80er Jahre als das böse Jahrzehnt, das die Utopie Disco beerdigt hat. So sind nicht nur in der Pop-Zeitmaschine von Pulp Fiction die 80er gänzlich abwesend, auch ein Retro-Film wie Paul Thomas Andersons Boogie Nights (1997) erzählt die Geschichte der Disco-Ära als eine langsame Verfallsgeschichte, die im Film ganz symbolisch mit dem Jahreswechsel 1980 in Gang gesetzt wird. Überhaupt mutet Boogie Nights wie ein verkapptes Westküsten-Remake von Saturday Night Fever an, mit dem Unterschied, dass der popkulturelle Signifikant „Disco“ hier mit „Porno“ gleichgesetzt wird. Wie Tony Manero wird auch Dirk Diggler (Mark Wahlberg) von demselben proletarischen Ehrgeiz getrieben, gute Arbeit am eigenen Körper zu leisten. Nur ist Diggler nicht mit den Dance-Skills von Manero gesegnet, sondern mit der ausgeprägten Größe seines Gemächts, das ihn schließlich zum „Superficker Pornostar“ machen wird. In zwei Szenen bezieht sich Boogie Nights ganz explizit auf seinen Vorgänger: Diggler, der genau wie Manero vor exakt denselben Postern von Bruce Lee und Al Pacino narzisstische Gesten vor dem Spiegel probt, und eine „Hustle“-Nummer, in der die Tänzer mit kreisenden Armbewegungen und Hüftdrehungen Manero fast eins zu eins imitieren.
Im Dialog mit Saturday Night Fever begreift auch Boogie Nights Disco sowohl als Individuierungs- als auch als Kollektivierungsprinzip, das quasi organisch mit dem Lebensentwurf der Pornokultur harmoniert. So rekonstruiert auch dieser Film die Pornografie der 70er im Stande ihrer Unschuld: Vor dem Aufkommen von Video, vor seiner gnadenlosen Kommerzialisierung und vor dem Konservatismus der Reagan-Ära. Mit Beginn der 80er verlieren sowohl Disco als auch Porno diese Unschuld: Reines Kokain wird durch schlechtes Speed ersetzt, das Experimentierfeld des „Kunst-Pornos“ wird durch Video beschnitten und die Community wird durch Konkurrenzkampf zersetzt. Während Pulp Fiction zu Disco eine ironisch kodierte historische Distanz herstellt, bekennt sich Boogie Nights offen zu seiner Retro-Melancholie: Die discofizierten 70er erscheinen hier als die schöne verlorene Zeit. Auch wenn man diese Melancholie nicht unbedingt teilen muss, verweisen diese filmischen Versuche einer „Defense of Disco“ (Richard Dyer) auf eine soziale Verlusterfahrung: dass nämlich die Disco zugleich eine Discommunity begründet. Wir müssen den „Hustle“ wieder lernen.
Saturday Night Fever ist bei Paramount erschienen. Dieser Text wurde zuerst in De:Bug Ausgabe 144 veröffentlicht.