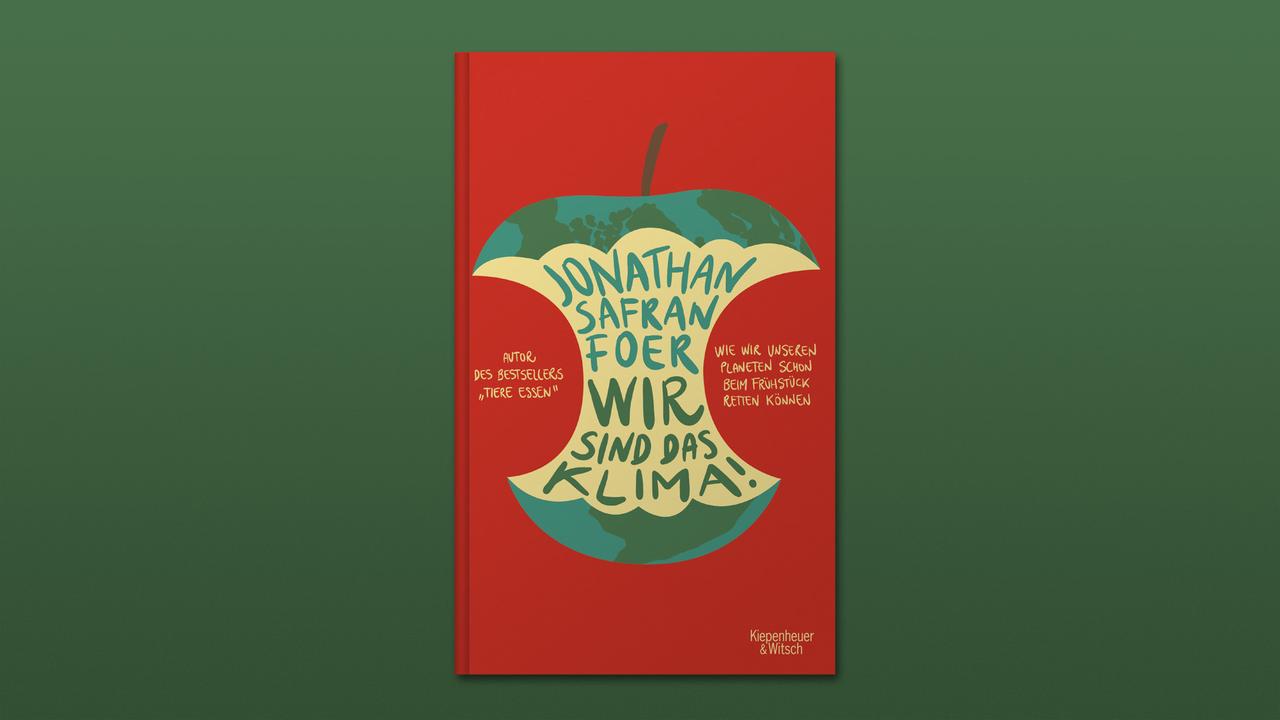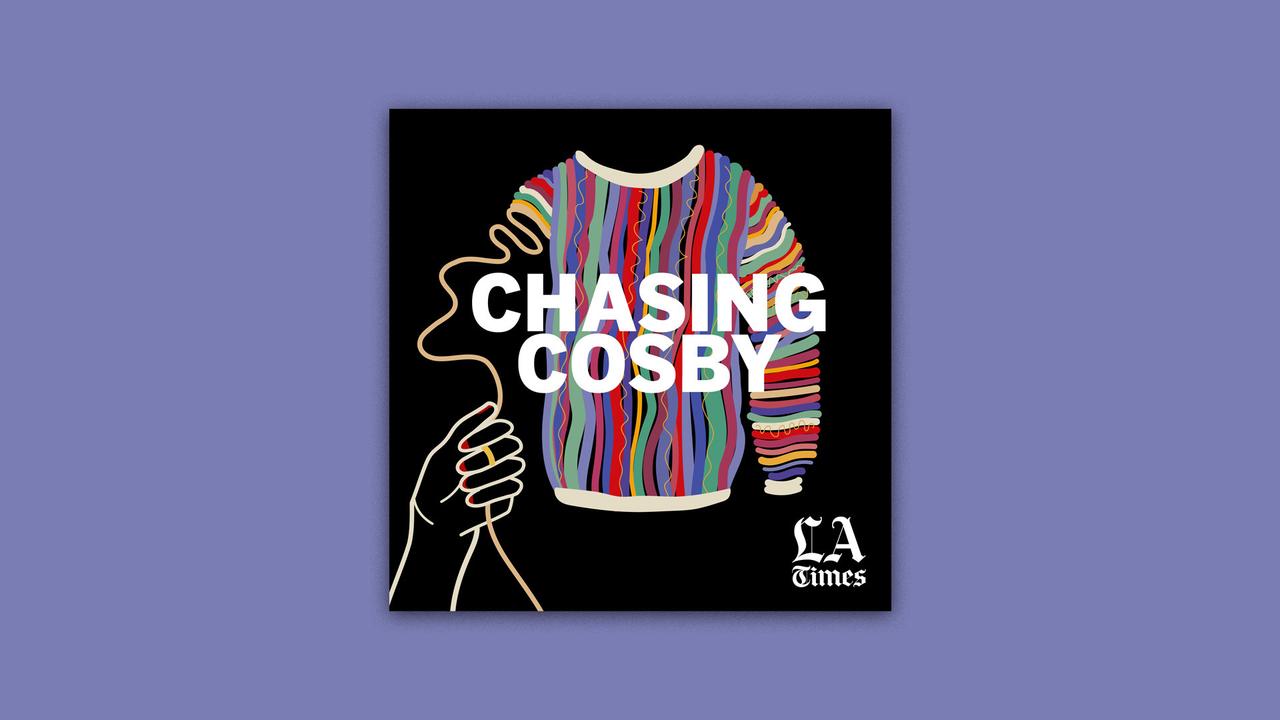Wir sind zu niedlich, um böse zu seinBuchkritik: „Im Grunde gut“ von Rutger Bregman
17.4.2020 • Kultur – Text: Jan-Peter Wulf
Es ist wohl das richtige Buch zur richtigen Zeit: Eines, das uns erklärt, dass wir eigentlich gar nicht so unsozial sind, wir wir immer von uns denken. Star-Historiker Rutger Bregman fährt jede Menge Beispiele und Gründe dafür auf, warum wir unser Selbstbild neu malen sollten.
Beim Rowohlt-Verlag müssen derzeit die Korken knallen. Das Buch des jungen niederländischen Historikers Rutger Bregman, das – so hört man – kein anderer deutscher Verlag übersetzen und publizieren wollte, hält sich ordentlich in den Sachbuch-Charts. Und die großflächige Außenwerbung, die man zum Buchlaunch in den Städten platziert hat, tut dies auch – es finden ja derzeit keine Events statt, die es zu bewerben gäbe, also klebt auch niemand was drüber. Überall in Berlin sind derzeit philanthropische Sprüche zu lesen, die das Buch anpreisen. Gut, es laufen derzeit auch ein paar Leute weniger dran vorbei, wegen Corona. „Im Grunde gut – eine neue Geschichte der Menschheit“ heißt das neue Buch Bregmans, im Original denkbarst putzig „De meeste Mensen deugen“, die meisten Menschen taugen was. Bregman, der sich zuvor mit „Utopien für Realisten“ fürs BGE stark gemacht hat und 2019 in Davos die Bühne nutzte, um zu sagen, ein Kernproblem seien die Reichen, die keine Steuern zahlen (korrekt), hat sich nun nichts Geringeres als die Menschheit zum Thema gemacht.


Seine zentrale These: Die „Fassadentheorie“, die Behauptung, der Humanismus-Humus sei dünn, unsere Zivilisation nur eine fragile Schicht über einem dicken Untergrund aus Egoismus, Boshaftigkeit und feindseligem Naturzustand, ist schlicht falsch. Und dass wir an diesen Urzustand glauben, habe viel mit der Tatsache zu tun, dass wir alles, was wir über die Welt wissen, aus den Medien wissen, wie uns schon Niklas Luhmann lehrte. Gewalt, Krieg und Co. sind die Regel bestätigende Ausnahmen. Nachrichten wirken wie eine schlechte Droge, die uns permanent im „Gemeine-Welt-Syndrom“ gefangen halten. Es sei Zeit für einen neuen Realismus, so Bregman: Wir sind viel besser, als wir glauben.
Homo puppy
Das hat ihm zufolge etwas mit unserer Natur zu tun: Wir sind von Haus aus friedliebend und qua Evolution gar nicht dafür gemacht, egoistisch und schlecht zu handeln. Wir können nämlich unsere Blicke und Emotionen nicht tarnen. Als einzige Primaten haben wir keine dunklen, sondern weiße Augen rund um die Pupillen, das verrät unsere Blickrichtung. Auch unsere Augenbrauen machen ein tierisches Pokerface unmöglich. Und wir erröten als einziges Wesen. Die Evolution hat uns Gesichtsmerkmale geschenkt, die unsere eigentliche, innere Freundlichkeit begleiten: „Homo puppy“ nennt Bregman uns mit unseren weichen Zügen und stupsigen Näschen, wir seien schlichtweg zu niedlich, um böse zu sein. Gesellig seien wir schon immer gewesen, anders als historisch kolportiert schlugen sich primitive, nomadische Gesellschaften eher weniger die Köppe ein, vielmehr pflegten sie den Austausch über ihre kleinen Gruppen hinaus, hatten viele soziale Kontakte. Jagdbilder zeige die historische Höhlenmalerei, aber keine Kriegsbilder. Und dem fiktiven antihumanistischen Schulbuchklassiker „Lord Of The Flies“ stellt er die wahre Story von sechs tonganischen Jugendlichen entgegen, die es 13 Monate miteinander gut auf einem kleinen Felsen aushielten, auf dem sie gestrandet waren, bis sie gerettet wurden. Das macht Mut für #stayathome.
Der Historiker, der für das Buch jahrelang recherchierte, erklärt, dass die Zivilisation der Osterinsel nicht, wie bisher oft behauptet, durch internen Kannibalismus, sondern durch externen Kolonialismus zerstört wurde. Dass Soldaten in Kriegen dazu tendierten, über den Feind drüber weg oder gar nicht zu schießen, Flinten mit Munition zu überladen, um ein Nachladen zu faken, Bajonette nicht zu verwenden – forensische Analysen hätten dies immer und immer wieder ergeben. Kriege dienten vor allem dem Machterhalt der Souveräne, moderne Kriegsführung sei sich der Tatsache bewusst, dass Töten den Menschen nicht so leicht fällt – deswegen Drogen schon ab dem ersten Weltkrieg und in Vietnam bekanntlich in rauen Mengen. Der Kampf gegen den Feind, für das Vaterland, die Ideologie, sei kein Motivator, vielmehr die Kameradschaft, das Füreinander-Einstehen. Böses anrichten, das könne ein „gutes“ Team zweifellos, von der Wehrmacht bis zum Dschihad zeitigt der Gruppen-Zusammenhalt immer wieder Schlimmes, das weiß auch Bregman. Doch die Vielzahl von Beispielen, in denen das Gute funktioniert und reüssiert – eine schon lange praktizierte Allmende im jeglichen Hippietums unverdächtigen Alaska, die denkbar liberale norwegische Gefängnis-Praxis mit rekordverdächtig niedrigen Rückfallquoten oder beinharte kolumbianischen Rebellen, die mit weihnachtlichen Botschaften zum Schmelzen und nach Hause zu Mama gebracht wurden, sie sind schon interessant.

Im Grunde gut (Affiliate-Link)
Okay. Was macht man nun damit? Im oben eingebetteten Podcast-Interview rät Bregman dazu, die Default-Einstellung von „eher schlecht“ auf „eher gut“ zu switchen. Denn: „What you assume in other people is often what you get out of them. If you assume that most people are selfish, aggressive and you name it, than you start designing your society around that idea (…) and you will create the kind of people that your theory presupposes.“ Heißt: Man kann sich eine gute Welt auch ein Stück weit selbst gestalten. Genauer: nicht man, sondern wir alle zusammen können das. Der wichtigste Satz des Buches fällt am Ende: „Eine bessere Welt fängt nicht bei einem selbst, sondern bei uns an.“ Der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt, sowieso, immer.