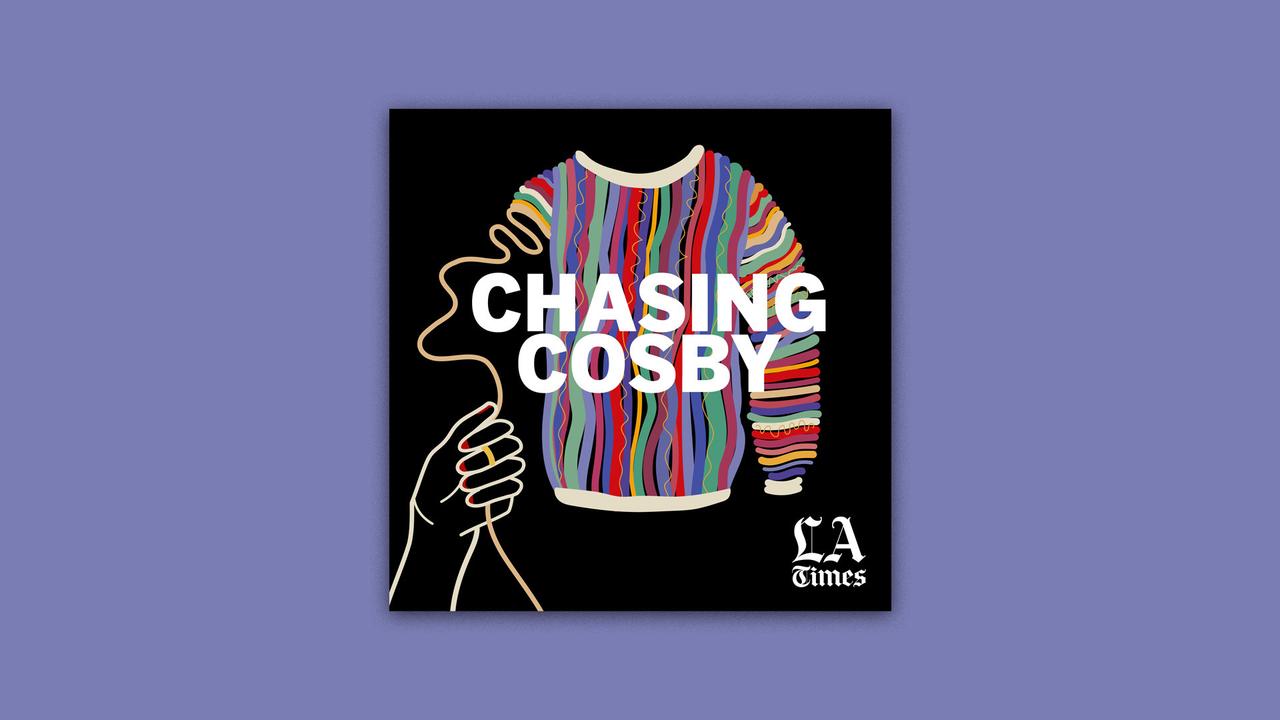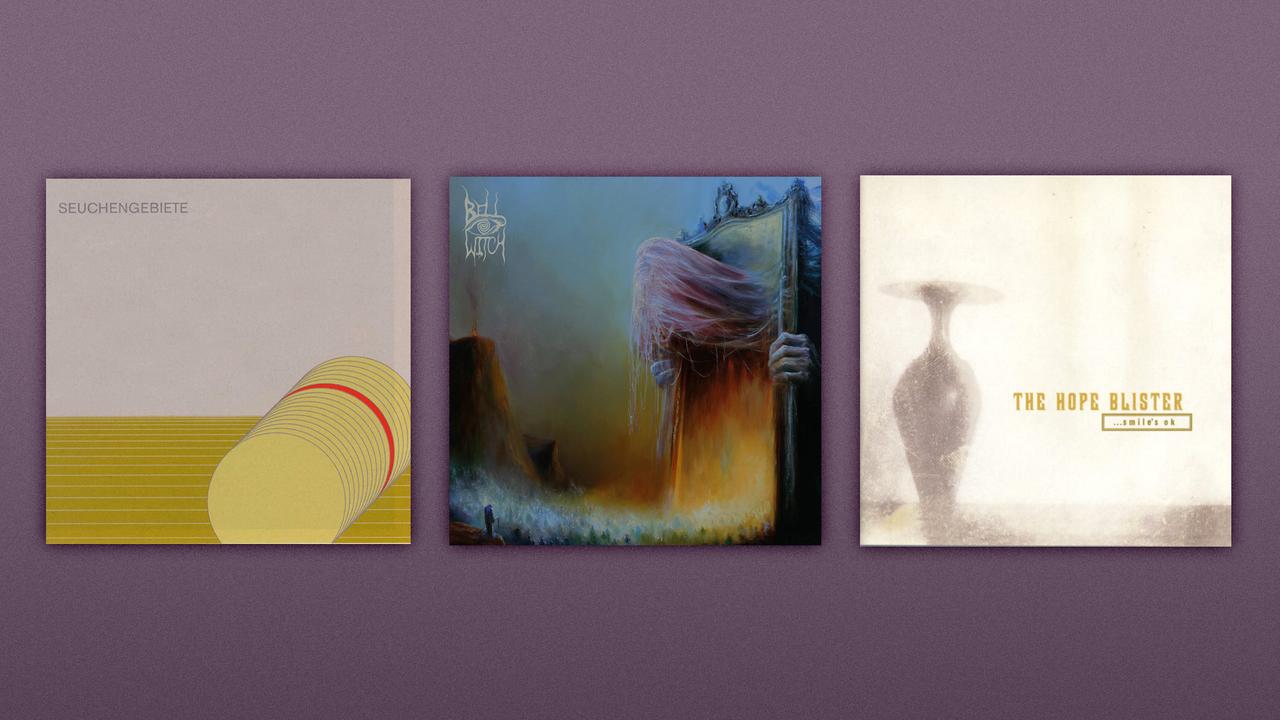Wir bleiben zu Hause, wir gucken Heimkino: Empfehlungen von Sulgi Lie für die Wohnzimmerleinwand. Takeshi Kitano zelebriert in Outrage wie gewohnt Gewalt in allen Facetten. Essstäbchen und Zahnbohrmaschinen werden ganz humorlos zu Pinseln blutroter Farbe. Unser Filmautor fragt sich: Ist Kitano noch „Beat Takeshi“? Und kommt die Yakuza zukünftig ohne Clown aus?
„Das ist kein Blut, das ist Rot“, lautet ein berühmtes Bonmot aus Jean-Luc Godards Weekend. Takeshi Kitano hat seine Filme von jeher gerne in intensivem Rot gemalt, von den dunklen Blutlachen seiner früheren Gangster- und Polizeifilme bis hin zum Rot von Yohji Yamamotos Kostümen aus Dolls und den digital drapierten Blutspritzern aus Zatoichi. Nicht zufällig heißt der Film, der ihn Mitte der 90er Jahre weltweit bekannt gemacht hat, Hana-bi, auf Deutsch: „Feuerblume“. Aus diesem Umschlagen von Blut in Rot, vom Naturalismus der Action zum Anti-Naturalismus der reinen Farbe, beziehen Kitanos Filme ihre spezielle Komik: Die Gewalt wird zum Gag und der Gag wird zur Gewalt. Unter dem Pseudonym „Beat Takeshi“ hat Kitano als Fernsehkomiker angefangen, etwa mit seiner äußerst schrägen Fernsehshow Takeshi’s Castle, in der die bemitleidenswerten Teilnehmer durch allerlei sadistische Parcours geschickt wurden – möglichst lange mit voller Blase auf einem Pferd sitzen und ähnliches. Zerdehnung und Entladung, Anspannung und Kontraktion, darum geht es auch in den Action-Burlesken Kitanos: Auf ein langes bewegungsloses Ausharren fährt Kitanos Faust urplötzlich in die Visage seiner Gegner, so abrupt wie das unwillkürliche Zucken seines Gesichts, das sich Kitano nach einem schweren Motorradunfall zugezogen hat.
Gewalt und Gegengewalt
Mit dieser stolpernden, dysfunktionalen Action ist es jedoch in seinem neuesten Film Outrage erst einmal vorbei. Nach einer Reihe von eher selbstreflexiven Arbeiten kehrt Kitano zum Yakuza-Genre zurück, aber der krassen Gewalt ist diesmal jeglicher Humor entzogen. Der Plot lässt sich auf eine Minimaldefinition zurückführen: Aktion und Reaktion, Gewalt und Gegengewalt. Nach einem eher unbedeutenden Zwischenfall dezimieren sich zwei Yakuza-Familien gegenseitig in einer Kettenreaktion der Gewalt, die sich mit dem Automatismus einer physikalischen Gesetzmäßigkeit vollzieht. Von den großen Bossen bis hin zu den kleinen Handlangern bleibt niemand verschont, bis zum Schluss niemand vom ursprünglichen Personal mehr übrig ist. Kitano hat den Film streng als einen dezentrierten Ensemble-Film angelegt, in dem keine Figur eine privilegierte Handlungsposition einnimmt. Auch Kitano selbst nicht, der als Killer die Aufträge seiner Bosse folgsam durchexerziert. Niemand gewinnt an individueller Kontur, alle sind austauschbar, wenn jemand stirbt, gibt es immer einen anderen, der ihn ersetzt. Outrage entwirft ein vollkommen gleichförmiges Universum, das nur mehr Entsprechungen kennt und keine Unterschiede: Die Yakuza ist ein autokratischer Männerbund ohne Frauen, der sich selbst kreiert hat und nun selbst zerstört. An den traditionellen Ritualen wird dennoch festgehalten, obwohl sie längst sinnlos geworden sind: Das obligatorische Abschneiden des kleinen Fingers als Ehrerbietung wiederholt sich fast schon als Running Gag durch den ganzen Film, nur dass jetzt ein schlichtes Teppichmesser dafür herhalten muss, was früher mal einen zeremoniellen Wert gehabt haben mag. In Outrage wird Gewalt in allen Facetten zelebriert, aber zur Zeremonie (so der Titel eines 70er-Jahre-Films von Kitanos Regiekollegen Nagisa Oshima) taugt sie eben nicht mehr. So machen die Gewaltexzesse in dem Film auch keinen richtigen „Fun“, weil sie eben weder komisch gebrochen noch poetisch überhöht werden, sondern sich im mechanischen Leerlauf höhepunktlos verflachen. So etwas wie Individualität und Kreativität gibt es nur in der Erfindung verschiedenster Todesarten und ungewöhnlicher Mordwerkzeuge, von Essstäbchen bis zur Zahnbohrmaschine. Das Ultrabrutale ist ultrafunktional geworden.
Hinter dem kalten Hauch
Immer erfasst die Kamera in langsamen Parallelfahrten die anonymen Gangster in ihren Businessmen-Outfits zu monochromen Tableaus. Eine Welt aus metallischem Grau-Blau hat das Rot der Feuerblume verschluckt. Aus der total gewordenen Gleichförmigkeit des männlichen Gewaltsystems sind auch alle romantischen Fluchtlinien von Kitanos früheren Filmen verschwunden: die stummen Frauenfiguren, die Freundschaft zwischen Männern, die Bewegung hin zum offenen Horizont des Meers. Auch die elegische Musik von Kitanos Stammkomponisten Joe Hisaishi ist nun von einem monotonen Score ersetzt worden, der auch die akustische Atmosphäre des Films in Neutralität taucht. Hinter dem kalten Hauch, den Outrage in jeder Einstellung verströmt, versteckt sich keine Melancholie und keine Nostalgie mehr. Das unterscheidet ihn von verwandten amerikanischen Filmen wie Simon Wests Action-Juwel The Mechanic, der die reine Mechanik der Gewalt mit homo-erotischen Affekten und existenzialistischen Gesten auflädt. In Outrage ist der Tod des Individuums von Beginn an eine besiegelte Sache. Dem perversen Korporatismus der Yakuza ist die eigene Destruktion quasi einprogrammiert.
Damit erinnert Kitanos humorloser Todesreigen an einen der besten japanischen Filme der letzten Jahre – Koji Wakamatus United Red Army (2007), der in quälenden drei Stunden die Selbstzerstörung der japanischen Linksterroristen der 60er Jahre protokolliert. Man muss Kitanos Film nicht unbedingt als einen Kommentar auf die japanische Gesellschaft lesen, dafür ist Outrage zu sehr einer puristischen Genre-Mechanik verpflichtet. Aber durch die rigorose Schematisierung und Funktionalisierung der Gewalt ist der Film für einen Genre-Film merkwürdigerweise fast schon zu abstrakt.
Vielleicht ist der „späte“ Kitano dem „frühen“ Kitano dann doch näher als es scheint. Doch man vermisst schon etwas den Clown im Yakuza: Ist Takeshi Kitano noch Beat Takeshi? Möglicherweise gibt uns der bereits angekündigte Outrage 2 darauf eine Antwort.
Outrage ist bei Capelight erschienen. Dieser Text wurde zuerst in De:Bug Ausgabe 155 veröffentlicht.