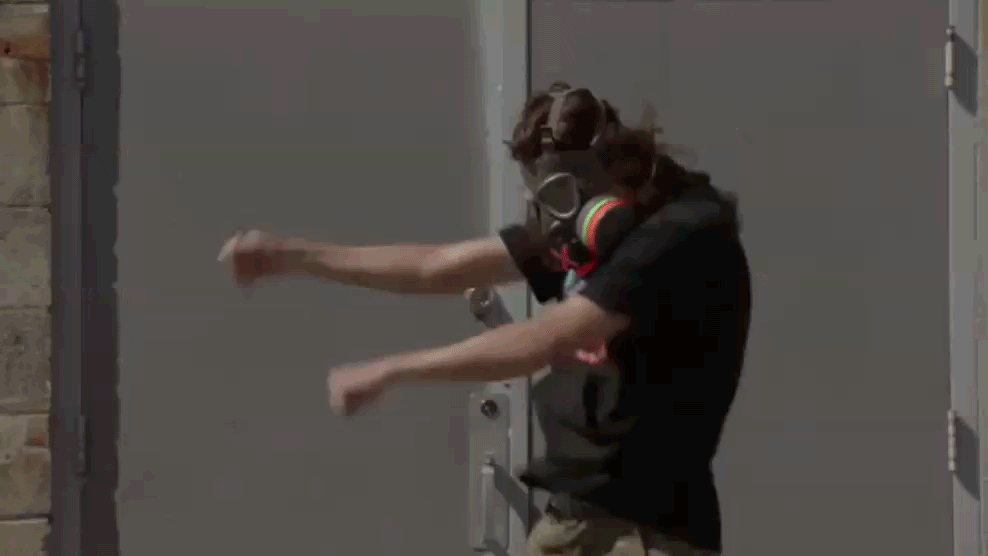
Drei Alben, drei Tipps, drei Meinungen. In unserer samstäglichen Filter-Kolumne wirft die Redaktion Musik in die Runde, die erwähnenswert ist. Weil sie neu ist, plötzlich wieder relevant, gerade entdeckt oder nie vergessen. Und im Zweifelsfall einfach ein kurzweiliger Zeitvertreib ist.

##Camara – Before We Sleep
Benedikt: Man nehme Electronica und Techno-Elemente, entschleunige sie mit Dream-Pop-Einwürfen und füge eine Portion psychedelische Chaotik hinzu, fertig ist „Before We Sleep“. Na gut, ganz so einfach hat es sich Fatima Camara mit ihrem Debüt-Album sicherlich nicht gemacht. Die Produzentin ist in Kanada geboren und aufgewachsen, mittlerweile hat es sie – wohin auch sonst – in die deutsche Hauptstadt verschlagen. Die erste Single des Albums „Just Waking Up“ kam bereits Anfang März, das Album klingt anders – zum Glück. Es hätte sicher keinen Platz in dieser Liste, wenn mich die Vocals der Single, die ein wenig nach Beach House in Hustensaft-Slomo klingen, über die vollen dreißig Minuten hinweg gequält hätten. Stattdessen bringt Camara raue Technoklänge in völlige Harmonie mit metallisch gefilterter – oder nah am Steg angeschlagener – E- und Bass-Gitarre. Die Stimme kommt erst zum Schluss auf der erwähnten Single dazu, noch besser dann aber im letzten Track „Sinking Calm“. Ein faszinierend langsames Album, das letztlich doch irgendwie im Pop ankommt, den Strecke dorthin aber auf ganz eigenen Pfaden beschreitet.
Album bei iTunes

##The Body – No One Deserves Happiness
Susann: „No one deserves happiness“ dachte sich wohl nicht nur das Duo The Body, sondern auch der Berliner Frühling. Dieser vielversprechende Titel und die darauf enthaltenen nihilistischen Klänge sind nun mein Vorschlag für einen Soundtrack zum kalten, (vermeintlich) revolutionären 1. Mai. Nach eigener Auskunft schufen Chip King und Lee Buford mit ihrem fünften Studioalbum das „grossest pop album of all time“ und unter Anbetracht der Vorgängeralben kann man das durchaus glauben. Für ungeübte Ohren ist „Krach“ und „Verzweiflung“ (anstatt Pop) allerdings auch eine nachvollziehbare Assoziation. Während sich noch in früheren The Body-Reviews fähige Musikjournalisten mit der weiteren Ausdifferenzierung des Genres Sludge/Doom Metal oder Noise beschäftigten, dürfte das neue Album diese Bemühungen endgültig beenden. Darauf vertretene Instrumente sind unter anderem eine 808-Drum-Machine, ein Cello und eine Posaune – und genannte Inspirationsquellen sind Beyoncé und Joan Didion. Vermutlich nichts mehr für Fans der ersten Stunde – für aufgeschlossenere Gemüter, die der Kombination Düsternis/Dance in diesem Genre etwas abgewinnen können, eine willkommene Abwechslung aus der sonst so schnurr- und vollbärtigen Indie-Rock-Stadt Portland.
Album bei iTunes

##Andy Stott – Too Many Voices
Thaddeus: Hier hat sich jemand gefunden. In diesen unberechenbaren Zeiten – das gilt für alle Lebensbereiche, von der Politik bis zur Musik: Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke auf einen wartet – nutzt Andy Stott genau diese Erkenntnis, die sich sowohl in Unbehagen als auch in einem wohligen Kribbeln äußern kann, um diese beiden Extreme musikalisch zu verbinden. Denn Stott kommt aus der einen Ecke und landet urplötzlich in der anderen. Seine frühen Entwürfe versuchten sich – sehr erfolgreich – an einer Weiterentwicklung des kleinsten gemeinsamen Nenners des Dancefloors: Dubtechno. Gut abgehangene Miniaturen mit dem maximalen frischen Wind, der aus diesem üppig ausdefinierten Sound noch herauszuholen war. So waren die Zeiten damals. Und es war gut, dass Stott hier etwas Fundamentales beisteuerte. Aber Stott ist eben auch nur Künstler und seinen Idolen nachzueifern ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Was folgte, war ein radikaler Bruch. Ein Bruch, der vielen angestammten Fans vielleicht zu radikal, zu unerwartet durch die Ohren fuhr. Die neue Dunkelheit, das Heraufbeschwören eines musikalischen Erzählstrangs jenseits nachvollziehbarer Ordnung war wichtig (und lag im Trend), mündete jedoch in Platten, die man vielleicht noch gerne sammelte und sich ins Regal stellte, dann aber doch selten bis gar nicht hörte. Stott unterschied sich schon in dieser Phase jedoch deutlich von Kollegen und Mitstreitern. In all der Diffusität glomm immer ein helles Licht. Weit hinten, manchmal kaum wahrnehmbar und doch stets präsent. Auf „Too Many Voices“, Stotts viertem Album, furios mit brillantem Video angekündigt, ändert sich die Tiefenstaffelung. Gleißende Helligkeit dominiert die Kompositionen, Strukturen sind konkret inszeniert, abbildbar. Wie Stott seinen Sound auf dem neuen Album entwickelt und verfeinert hat, ist beeindruckend. Denn natürlich sind die neun Stücke alles andere als leicht zu verdauen, das wäre dann auch zu einfach. Stott gelingt es jedoch, beide Welten, beide Extreme – das Chaos und den Pop – so zu vermählen, dass daraus etwas Neues entsteht. Etwas, worauf viele schon lange gewartet haben. Ein spröder Entwurf von Pop, kantig genug, um nicht ins Seichte abzugleiten und doch einprägsamer und somit anschlussfähiger denn je. Was hinter der nächsten Ecke wartet, weiß man immer noch nicht. Stott nimmt uns jedoch die Angst, einen beherzten Blick zu riskieren. Schon jetzt eines der besten Alben 2016.
Album bei iTunes











