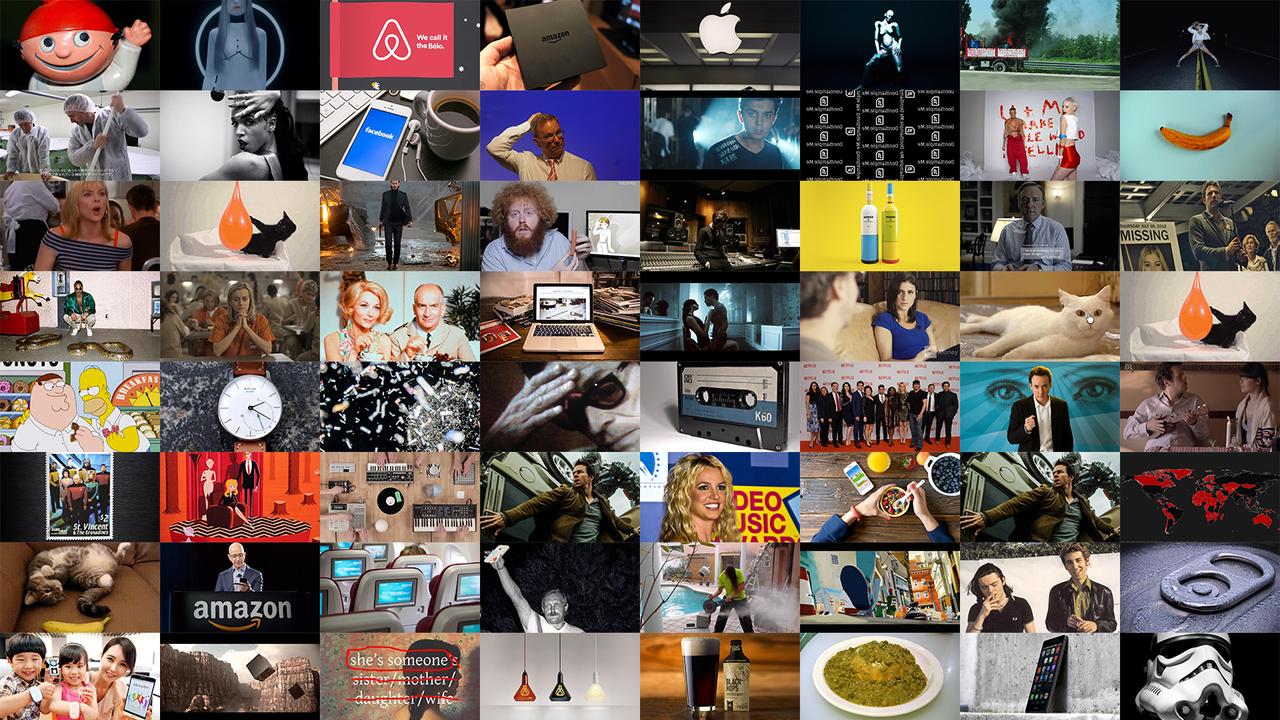„Nach dem High musste der Absturz kommen.“Die belgische New-Beat-Legende Ro Maron im Interview
6.3.2015 • Sounds – Interview: Ji-Hun Kim, Thaddeus Herrmann, Bilder: Benedikt Bentler
Denkt man an die Geschichte von Clubkultur und elektronischer Tanzmusik, scheinen die meisten geografischen Eckpfeiler klar: Manchester, Chicago, Detroit, später Berlin. In den Jahren 1988-1990 sorgte aber ein Sound aus Belgien international für extatische Dancefloors, der heute fast in Vergessenheit geraten ist: New Beat. Ein greller, im Tempo gedrosselter Bastard aus Acid, EBM, Punk, Pop und frühem Techno, der seinerzeit zum großen Hype wurde. Helle Sternschnuppen sind aber zum Verglühen verdammt, das war auch hier so. Allerdings hatte das auch politische Gründe.
Einer der musikalischen Protagonisten dieser Szenerie ist Rembert De Smet. Als Ro Maron und unter dutzenden anderen Künstlernamen produzierte er im Akkord Club-Hits, die nicht nur das damalige Diskotheken-Epizentrum Boccaccio in der Nähe von Gent beschallten. Anfang des Jahres erschien die Compilation „Ro Maron – Collected“ auf dem Schweizer Label Mental Groove. Die erste große Werkschau dieser Art. Speziell auch deshalb, weil Ro Maron mit Clubmusik eigentlich nichts mehr am Hut hat. Heute ist er in Belgien vor allem für seine Flamenco-Musik mit flämischen Texten bekannt. Wir trafen den sympathischen Leidenschaftsmusiker in Berlin und ließen uns alles mal erklären. Von gestressten Bauern, Fließbandökonomien und einem folgenschweren DJ-Fehler.
Welche Rolle spielt aktuell Club-Musik bei dir?
Es geht gerade wieder ein bisschen los. Aber eigentlich nur, weil mein Sohn begonnen hat, elektronische Musik zu machen. Ich sehe, dass er ganz anders an Musik und Sounds herangeht, als ich noch zu meiner Zeit. Das finde ich interessant. Aber an und für sich ist Dance-Musik nicht meine erste Wahl.
Wie kam es überhaupt zu der Compilation?
Vor ein paar Jahren fingen einige DJs aus England an mich anzuschreiben. Sie waren alle von dem Track „Something Scary“ von Zsa Zsa „La Boum“ begeistert, hatten ihn irgendwo ausgegraben und fragten mich, wie ich diese 303-Sounds hinbekommen hätte. Zur gleichen Zeit bekam ich aber auch dutzende Anrufe von Weinhändlern aus Bordeaux. Das war irgendeine neue Vertriebsmasche und diese Anrufe verfolgten mich eine gute Woche lang. Als eines Tages wieder ein französisch sprechender Mann am Telefon war, wollte ich ihn schon abwimmeln und sagen, dass ich keinen Wein wolle, ob ich ihm nicht stattdessen belgisches Bier verkaufen könne. Er stellte sich aber als Olivier Ducret vom Schweizer Label Mental Groove aus. Er wollte mit mir darüber sprechen, ob ich Interesse hätte, meine alten Songs neu zu veröffentlichen. Da bin ich den Falschen so grob angegangen. Ziemlich peinlich (lacht).
Wie ging es weiter?
Er erklärte mir, wie er sich das Projekt vorgestellt hat und nannte mir einige Nummern, die er sich wünschte. Ich fragte, woher er all die Tracks kennt, woraufhin er meinte, dass er die meisten auf YouTube gefunden habe. Im letzten Sommer kam er mich in Gent besuchen. Ich fing zuvor an, alte Betamax- und Mastertapes heraus zu suchen – im teils furchtbaren Zustand. Das hat ungefähr zwei Monate gedauert. Am Ende waren es ca. 70 Tracks, woraus dann eine Auswahl getroffen wurde.
Bevor Rembert De Smet ins New-Beat-Geschäft einsteigt, macht er Popmusik. Sein bis dahin größter Hit: „Lena“ von 1985 mit seinem Act 2 Belgen.
Anfang vom Ende? 1988 wurde „The Sound of C“ von Confetti's zum ersten mainstream-fähigen New-Beat-Hit. Dann ging plötzlich alles sehr schnell.
Für dich war das Kapitel New Beat eigentlich Geschichte.
Ich hatte in der Tat keine Ahnung, wieso sich auf einmal vor allem jüngere Menschen wieder dafür interessierten. Die Labels sahen das ähnlich. Der Großteil meiner Tracks ist seinerzeit auf dem belgischen Label „Antler Records“ herausgekommen. Die wurden irgendwann von EMI übernommen. Dann hat sich Warner die Rechte gesichert, die dann in die Hände von Sony gelangten usw. Wir haben versucht, einen Ansprechpartner zu finden, der mit uns die Rechte klären und uns vor allem auch die originalen Master besorgen konnte. Niemand hatte auch nur die leiseste Ahnung, wo man hätte suchen sollen. Schließlich sagte man uns nur: Macht mal einfach und lasst uns wissen, wenn es fertig geworden ist.
War es denn einfach?
Der Prozess war in vielerlei Hinsicht spannend. Teils fand ich acht Versionen von einem Song, ohne zu wissen, welche dann tatsächlich veröffentlicht worden war. Auch konnte ich mich an die allerwenigsten Songtitel erinnern – auf die Tapes waren meist nur alberne Arbeitstitel gekritzelt. Olivier war die treibende Kraft. Er hat die Idee verfolgt und sich liebevoll um alles gekümmert. Bis zu diesem Zeitpunkt war New Beat für mich ein längst vergangener Lebensabschnitt, der ja faktisch auch nur zweieinhalb Jahre gedauert hatte.
Zweieinhalb Jahre sind wirklich kurz.
Das mit New Beat ging alles sehr schnell. Am Anfang noch cool und ziemlich underground. Alles war geheim und ominös. Als aber die Leute Geld gerochen haben, war es mit der guten Stimmung schnell vorbei. Das ging auf Kosten der Qualität. Der Ausverkauf begann mehr oder weniger mit „The Sound of C“ von Confetti’s von 1988. Ein toller Track, der zum großen Hit avancierte und später weltweit über Majors vertrieben wurde. Dann ging es mit den lauwarmen Aufgüssen los. Ein langweiliger Beat, dazu ein Video mit schlechten Tänzern. Das war es dann mit dem ursprünglichen Spirit.
War der belgische New Beat mit seinen DJs und Producern als eine Art Gegenbewegung gedacht?
Nicht nur. Es war auch finanziell einfacher. Ich hatte zuvor in Bands gespielt und da waren wir immer ein großes Team – Leute für den Sound, für das Licht. Wenn du dann einen Abend vor nur 50 Leuten spielst, macht das keine gute Laune. Irgendwie erschien es mir logisch, in diese Richtung zu gehen. Ich hatte in den frühen 80ern viel New Wave gehört – Fad Gadget und so ein Zeug – und irgendwann fingen alle an, Maxi-Versionen auf 12“ herauszubringen. Auf der B-Seite gab es häufig Dub-Versionen mit weniger Vocals, einfach mal den Beat rollen lassen, wieso Dinge kompliziert und schwierig machen?
Du hast unter unzähligen Pseudonymen New-Beat-Platten veröffentlicht. Als Reject 707, Kaos 007, Zsa Zsa „La Boum“ und vielen mehr. Welche Taktik steckte dahinter?
Die Gräben waren tief. Man musste sich entscheiden, ob man elektronische Musik oder was anderes machen wollte. Der Belgier ist zudem nicht sonderlich chauvinistisch. Gerade in der Kunst und Musik verdrehte man sofort die Augen, wenn es hieß, eine Platte sei aus Antwerpen oder Brüssel. Kam aber eine Platte aus Chicago, dann waren alle gleich Feuer und Flamme: „Hey Chicago, voll geil, super interessant …“ (lacht).
Man hat die Leute also an der Nase herumgeführt?
Je mysteriöser, desto erfolgreicher war eine Platte. Das hat die Gespräche angefeuert. „Weißt du, wo dieser Sleepwalker herkommt?“ „Ich hab nicht den blassesten Schimmer …“ Die Labels haben das Spiel mit der Geheimnistuerei nur zu gerne mitgespielt. So konnte ein immer größerer Hype darum entstehen.

Wie hat es sich angefühlt, nach fast 25 Jahren wieder die alten Tapes anzuhören?
Es war aufregend. Ich fand sie gar nicht so altbacken wie erwartet und bei vielen konnte ich noch immer die selbe Spannung spüren wie damals. Klar, wir haben damals quasi wie am Fließband produziert. Aber wir hatten unsere Ansprüche. Der Sound musste gut sein, die Licks mussten funktionieren. Bevor es ins Presswerk ging, sind wir mit den Tapes in den Club Boccaccio und haben sie auf der großen Anlage getestet. Danach ging es zurück ins Studio und es wurde der Feinschliff gemacht.
Was meinst du damit, ihr habt Musik wie am Fließband produziert?
Es wurde zu einer Art Wettbewerb. Man wollte schneller sein als der andere. Jeder wollte den nächsten Underground-Hit rausbringen. Für mich war es total neu festzustellen, dass sich eine in verhältnismäßig kurzer Zeit produzierte Maxi an zwei Tagen 2.000 mal verkaufen konnte. Plötzlich reichte eine gute Idee.
Wie fühlte es sich an, eine vollkommen neue Herangehensweise zu entwickeln?
Anfangs war es seltsam. Normalerweise, wenn man sechs Minuten Musik aufnehmen wollte, brauchte man zwei Songs – mit zwei Arrangements, zwei Songtexten etc. Bei meinen New-Beat-Tracks musste ich erst lernen, dass weniger mehr ist. Dass man einer Sequenz viel Raum überlasst – dass nach vier bis fünf Minuten ein tranciges Gefühl einsetzen kann. Rückblickend waren meine ersten Produktionen zu überladen. Im Laufe der Zeit wurden sie konkreter und auch besser, wie ich finde. Die ganze New-Beat-Geschichte hat mir ein anderes Gesicht der Musikkultur gezeigt. Auf einmal ging es Tag für Tag um den neuesten Scheiß von Leuten, von denen du noch nie zuvor gehört hast. Und alle haben mitgemacht: in Brüssel, Manchester, Berlin und London. Musik wurde viel schnelllebiger.
Wie standest du zu der Bezeichnung „New Beat“?
Ich wusste erst nicht, dass es überhaupt einen Begriff gab. Als ich das herausfand, fand ich es aber auch ein bisschen kindisch. Eigentlich habe ich Acid gemacht: ein Beat, eine 303, hohe, sägende Zwitschergeräusche. Mir waren zu der Zeit die ersten Chicago- und Detroit-Sachen wichtig. Die wollte ich mit der Idee des späten New Wave und mit Punk zusammen bringen. Ich war als Gitarrist fasziniert davon, wie man mit einer 303 verzerrte Gitarrenklänge imitieren konnte. Dafür habe ich sie so umgebaut, dass sie auch per Steuerspannung (CV/Gate) angespielt werden konnte. So konnte ich Klänge basteln, die nur mit MIDI nie entstanden wären.

Fehlt nur noch das YPS-Heft. Ro Maron in seiner belgischen Hitschmiede Ende der 80er. | Bild: Discogs
Als New Beat in Deutschland ankam, war die Konfusion in der hiesigen Musikszene erstmal groß. Auch weil man Belgien eigentlich immer mit EBM in Verbindung gebracht hat. Labels wie PIAS, Bands wie Front 242. Dann kamen plötzlich unzählige New-Beat-Tracks, und paradoxerweise teils auf den gleichen Labels und teils sogar von den selben Produzenten. Was war die Verbindung zwischen diesen beiden Szenen? Wie hat man sich das vorzustellen?
Eigentlich war es eine Art Übergang, weil zur Ära New Beat zeitgleich die EBM-Szene eingebrochen ist. Wir waren ja alles Musiker, keine DJs, und Musiker wollen eben Musik machen, egal ob live oder im Studio. Eines Tages brach der Markt wie ein Kartenhaus zusammen. Da einige von uns aber einen Zugang zu tanzbarer Musik hatten, war New Beat eine logische Konsequenz und Alternative. Was aber wegfiel, war das Live-Spielen. Wir mussten darauf hoffen, dass der DJ unsere Musik auswählt und für die Leute spielt. Eine gänzlich andere Situation.
Wie ist es zu dem typischen Sound gekommen?
Roland Beelen (Belucci), der mit Maurice Engelen (Praga Khan) gemeinsam Antler Records betrieben hat, war großer Fan von Adrian Sherwood. Dabei habe ich gelernt, was tiefe Bässe wirklich bedeuten. Diejenigen, die man nur auf großen Anlagen hören kann und dich sprichwörtlich wegblasen. Es konnten sich damals viele auf Dub, Ska und Reggae einigen. Wir liebten diesen tiefen, konstanten, wuchtigen Sound. Noch bevor die Zeit von Läden wie Boccaccio oder Ancienne Belgique losging, gab es in Aarschot – dort wo auch Antler Records saß – einen Laden namens Bluehouse. Eines Abends ging ich mit den Jungs zusammen aus. Sie meinten: Komm, wir gehen zu Theo! Theo war DJ im Bluehouse und er mixte Platten auf unglaubliche Art und Weise. Tiefe, düstere Streicher-Sounds mit runtergepitchten Dub-Tracks. Dann spielte er den Song „Flesh“ von A Split Second mit 33 statt 45 Umdrehungen. Wahrscheinlich ein Zufall, aber das Ganze schlug später ein wie eine Bombe. Dieser „DJ-Fehler“ gilt heute vielen als die Geburtsstunde von New Beat. Maurice war schon immer ein straighter und hemdsärmeliger Typ. Er meinte: Da ist was in der Luft. Da machen wir was draus. Das wird groß. Im Studio versuchte ich dieses Feeling, diese Wucht umzusetzen. Ich tat mich schwer zu Beginn, aber irgendwann schossen die Tracks nur so raus.
Damit soll alles angefangen haben: Der Song „Flesh“ von A Split Second aus dem Jahr 1986. Links das Original, rechts die Version auf 33 RPM.
Lass uns über Clubs wie das Boccaccio reden, die eng mit New Beat in Verbindung standen.
Zu der Zeit war ich bereits Mitte 30, und für mich war es eher eine Art Studienreise. Ich erinnere mich gut an das erste Mal im Boccaccio. Die Lightshow, der tiefe, fette Sound, das war beeindruckend. Der DJ mixte einen Rockbeat mit der berühmten Rede von Martin Luther King. Es gab keine Berührungsängste. Man nahm alle Stile zusammen und machte was Neues draus. Angesagt waren auch Mixe mit Jan Hammers Thema von Miami Vice: runtergepitcht und mit anderen Beats unterlegt. Die Leute sind ausgerastet. Ich fand das hoch kreativ. Ich habe das alles schon verstanden: die Euphorie, der Rausch, die jungen, gut aussehenden Menschen, richtig dabei war ich aber nie.
#„Irgendwann wurde New Beat im selben Atemzug mit Polizei, Razzia und Drogen genannt. Man fand in den Clubs teilweise kiloweise Speed und andere Substanzen.“
Als der Hype auf dem Höhepunkt schien, wurden viele Clubs in Belgien vor allem auch wegen Drogenproblemen geschlossen, darunter auch das Boccacio. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Das war keine schöne Zeit. Weil das Schließen der Discotheken auch zum Ende der Musik führte. Das beeinflusste sich gegenseitig. Sprach man von New Beat, wurden irgendwann in den Medien im gleichen Atemzug immer auch Polizei, Razzia und Drogen genannt. Aber ehrlich, es waren teils wirklich viele Drogen im Umlauf. Man fand in den Clubs kiloweise Speed und andere Substanzen. Das Bocaccio befand sich in Destelbergen in der Nähe von Gent. Das war ein Dorf, und auch viele andere Läden befanden sich eher in ländlichen Gegenden. Wenn aber in einer Gegend sonst nur Bauern leben und plötzlich jedes Wochenende junge Leute in protzigen Sportkarren durch dein Dorf brettern, dann führt das zu Konflikten. Auch deshalb wurde das schnell politisiert. Den Anwohnern war das wochenendliche Szenario mit betrunkenen Jugendlichen, lauten Auspuffen und schillernden Outfits einfach nicht geheuer.
Was hatte das für Auswirkungen auf die Szene?
Einige. Man muss sich das wie beim Fußball vorstellen. Wenn es bei einem Verein nicht mehr gut läuft, die Fangruppierungen sich untereinander nicht mehr verstehen, die Stimmung aggressiver wird. Und wo hätte man die Platten sonst hören sollen, wenn nicht in einem Club? In einem Café? Es gab aber zum Beispiel das Caré zwischen Antwerpen und Brüssel, die hatten weit weniger Probleme mit der Polizei und haben lange weitergemacht. Am Ende ging es aber nicht gut aus. Die Stimmung war gedrückt und negativ. Das ist alles so schnell in die Höhe geschnellt, das High war so intensiv, dass so ein Absturz unvermeidlich gewesen ist.
Das Boccaccio in den 80er Jahren.
Am Ende gab es aber insgesamt gar nicht so viele Produzenten, oder?
Zu Beginn gab es eigentlich nur vier Teams, die dennoch Tonnen an Platten in der Zeit herausgebracht haben. Zunächst gab es mich und meine Kollegen. Dann eben Maurice Engelen mit seinen Jungs. Dann gab es Herman Gillis/Sherman, der zusammen mit Roland Beelen Musik gemacht hat. Der Sherman, der heute die bekannten Filterbänke baut. Dann gab es einen jungen Typen aus dem Umfeld einer bekannten Diskothek in Aarschot. Mit der Zeit wurden es paar mehr. Vor allem DJs fingen an, eigene Sounds zu produzieren. Die aber beauftragten meistens Musiker und Produzenten, die den Job für sie erledigten.
Wie erklärst du dir, dass New Beat im Vergleich zu Techno oder House nur so kurz existieren konnte?
Das haben Hypes erstmal an sich und am Ende wurde es leider durch die Kommerzialisierung auch wirklich albern. Aber ich erkenne immer noch viele unserer Sounds in aktuellen Produktionen wieder und ich glaube, dass wir durchaus etwas bewegen konnten. Wenn man sich das größte belgische Festival Werchter zum Beispiel anschaut: Der Macher des Festivals wurde in den 80ern fürs Fernsehen interviewt, in dem er meinte: „So was wie New Beat, diese Art von Musik, solche Pseudo-Künstler werden nie im Leben auf meinem Festival spielen!“ Heute spielen auf dem Werchter die Hälfte aller Künstler elektronische Musik. Auch so riesige Events wie das Tomorrowland haben ihren Ursprung in Belgien. Die ziehen das zwar auf wie im Disneyland – zu viel von allem – aber es funktioniert. Ich sehe das schon als eine zusammenhängende Evolution.
Wenn dich das Berghain fragt, ob du ein Liveset als Ro Maron spielen möchtest. Was sagst du?
Die Sache ist, ich kann diese Musik live nicht spielen. Ich könnte Schallplatten auflegen, so tun als ob und ein paar affige Bewegungen dazu machen, oder eine Marionetten-Show einstudieren. Wenn live spielen bedeutet, nur ein Playback abzududeln, dann bin ich raus. Das interessiert mich nicht. Ich habe es damals auch schon abgelehnt, Ro-Maron-Tapes abzuspielen und ein bisschen Gitarre drüber zu spielen. Das bringe ich nicht übers Herz. Das ist mir nicht leidenschaftlich genug. Dafür mache ich keine Musik.

Ro Maron, Collected #1, ist bei Mental Groove erschienen. Album bei iTunes
Das bekannte belgische DJ-Bruderpaar 2manydjs/Radio Soulwax hat vor einigen Jahren einen Zweiteiler über Belgiens Clubkultur produziert. Teil 1 handelt von New Beat. Teil 2 spielt belgischen Gabber auf 33 RPM und entwickelt dabei eine unglaubliche Power. Wie damals. Tradition verpflichtet eben.