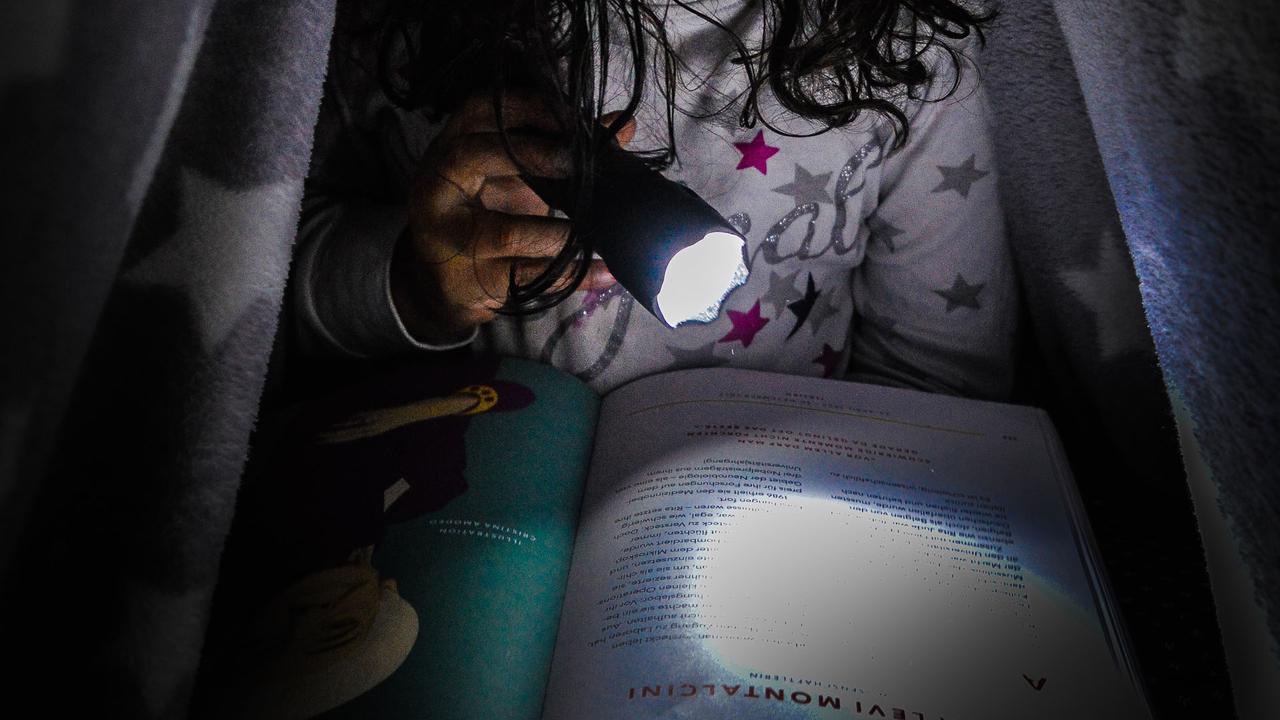Ein rassistischer DammbruchPodcast-Kritik: Floodlines
22.7.2020 • Gesellschaft – Text: Jan-Peter Wulf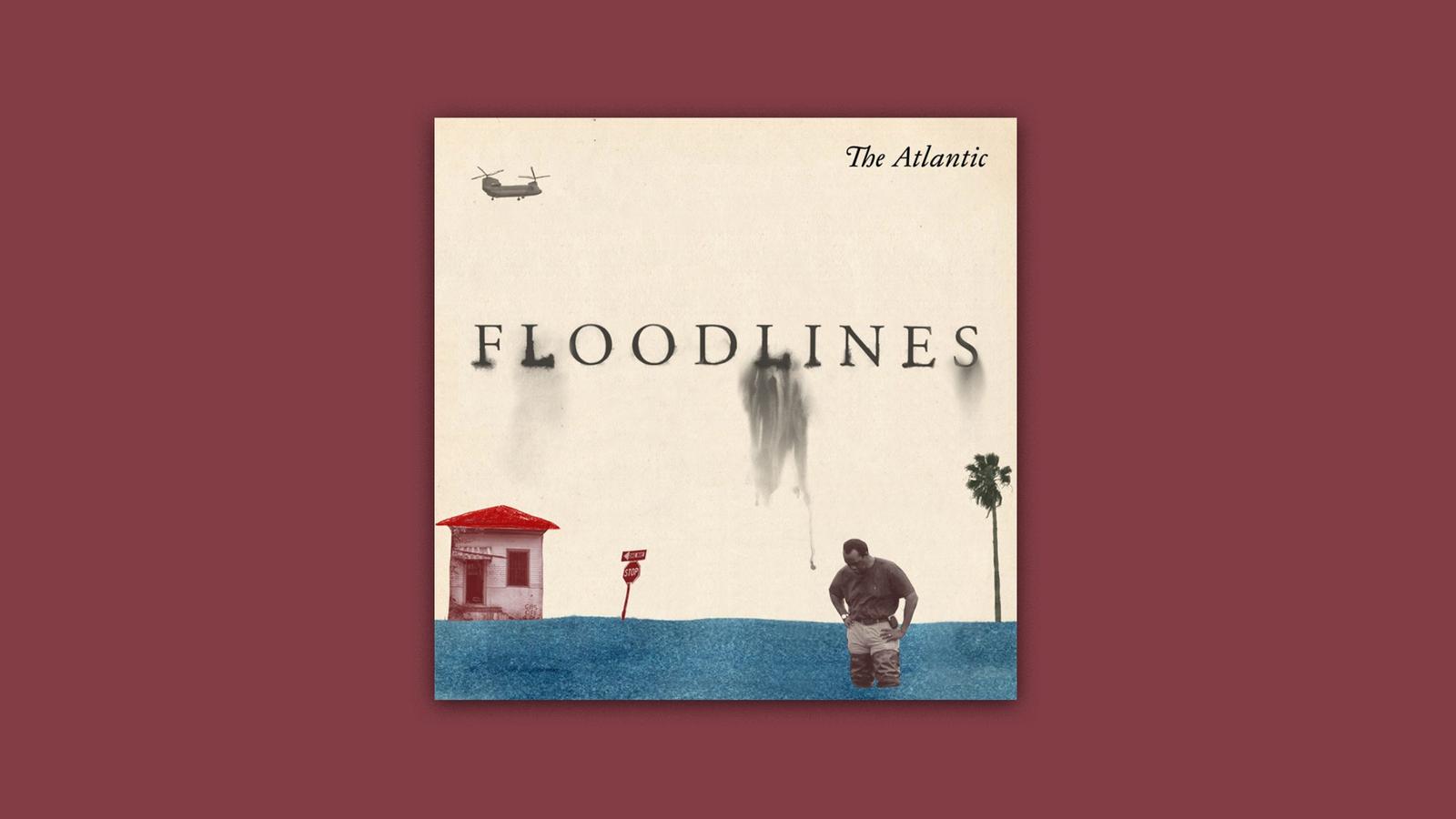
Dass 2005 in New Orleans so viele Menschen durch den Hurrikan „Katrina“ ums Leben kamen, hat mit dem Wirbelsturm nur indirekt etwas zu tun – vielmehr ist es trauriges Ergebnis einer maroden Infrastruktur. Das mediale Bild, das von den auf sich selbst zurück geworfenen, nach Lebensmitteln Suchenden gezeichnet wurde, war nicht minder zerstörerisch. Der Podcast „Floodlines“ zeigt auf: „Katrina“ hat den Rassismus der USA offengelegt.
Gerhard Schröder wurde 2002 noch einmal zum Kanzler gewählt, trotz zuvor mieser Umfragewerte. Den Turnaround hat er einem Hochwasser zu verdanken: Als die Oder im August des Jahres weit über ihre Ufer trat und an vielen Stellen Deiche brachen, war er gleich da. Die Bilder des in Gummistiefeln an den eilig mit Sandsäcken erbauten Behelfs-Schutzdämmen Stehenden gingen durchs Land. Der lange in den Umfragen hinter seinem Herausforderer Edmund Stoiber liegende Kanzler erwarb sich Sympathien und besetzte, zumindest für kurze Zeit, das hierzulande so wirkmächtige Kollektivsymbol des sorgsamen Landesvaters.
Drei Jahre später, im August 2005, bat George W. Bush den Piloten der Air Force One, auf dem Flug von seiner Heimat Texas nach D.C. einen kleinen Schwenker zu machen und ein bisschen tiefer zu gehen. Der amtierende US-Präsident wollte sich im Flyover-Modus ein Bild vom Ausmaß der Überschwemmung in der Deltaregion des Mississippi machen, die durch den Hurricane „Katrina“ ausgelöst wurde. Landen tat er nicht. Seine fehlende Präsenz (und die damit fehlenden photo options) bedauerte Bush später. Allerdings war er schon ein „lame duck“, eine weitere Amtszeit stand sowieso nicht mehr an.
Nicht zu den Menschen gekommen zu sein, lässt sich quasi als Nichteinstufung der Überschwemmung als nationale Tragödie interpretieren. Sie steht sinnbildlich dafür, wie seitens der Regierung mit der ganzen Lage vor Ort umgegangen wurde. Und damit sind wir mitten im Thema des achtteiligen Podcasts „Floodlines“ von „The Atlantic“. Er rollt das vor 15 Jahren Geschehene noch einmal auf. Wie konnte es dazu kommen, dass über 1.800 Menschen dem Hurricane zum Opfer fielen, die allermeisten von ihnen – 93 Prozent – Schwarze?
Es hat mit dem Wirbelsturm selbst eher wenig zu tun. Der kennt Hautfarben so wenig, wie ein Virus es tut. „Katrina“ war auch gar nicht so schlimm, nicht der zunächst befürchtete „big hit“. Die Katastrophe, die im Folgenden entstand, ist einmal mehr menschengemacht: Das umfangreiche Deichsystem, das die Stadtteile von New Orleans schützen sollte, hatte versagt. Nicht dass die „levees“ nicht hoch genug gewesen wären. Doch sie waren von den „army corps“ der USA, dem militärisch geleiteten Ingenieurswesen, der für solche Dinge zuständig ist, zum Teil schon aus unzureichendem, sandigem Material gefertigt worden und die Instandhaltung/Erneuerung war in der vergleichsweise armen – und vorwiegend von Schwarzen bewohnten – Stadt weitestgehend verschleppt worden. Nicht der Wind richtete den großen Schaden an. Das Wasser tat es, das durch gebrochene Dämme und Deiche meterhoch in die Stadtteile hineinflutete. Vier Fünftel der Stadt standen unter Wasser, teilweise siebeneinhalb Meter hoch bzw. tief.
Die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen lassen sich im Nachhinein nur als Desaster bezeichnen. So hatten die zuständigen Behörden es sogar tagelang nicht einmal richtig mitbekommen, dass sich die Menschen vor dem Wasser nicht nur in das örtliche Football-Stadion retteten (das heute tatsächlich „Mercedes-Benz Superdome“ heißt), sondern auch in das nur fünf Autominuten entfernte Kongresszentrum. Dort waren sie über Tage auf sich alleine gestellt, kaum jemand hatte die Möglichkeit gehabt, sich vorab mit einer Notration einzudecken. Keine hinreichende Versorgung mit Lebensmitteln und Bekleidung führte zur Selbstversorgung in umliegenden Geschäften. Die US-Medien indes machten Plünderungen daraus. Von einer „warzone“ und Begriffen wie „downtown Baghdad“ war die Rede, und schon bald überboten sich die Channels mit Schreckensgerüchten aus dem Kongresszentrum: Gewalt, Vergewaltigungen, Morde solle es dort geben. Eine Mär. Im Nachhinein wurde exakt ein gewaltsamer Todesfall bei Zehntausenden dorthin Geflüchteten notiert, gerade einmal 13 Waffen wurden beschlagnahmt. „Floodlines“ berichtet von der Verbringung vieler obdachlos gewordener Stadtbewohner*innen in andere Staaten, einhergehend mit der Bezeichnung bzw. dem Framing als „refugees“. Mangelnde Entschädigung und bis heute keine Übernahme der Verantwortung. Die letzte, besonders starke Folge des Podcasts lässt Michael Brown, damaliger Kopf der FEMA (Federal Emergeny Management Agency) und einer der Hauptverantwortlichen – einsichtig und die Schuld von sich weisend zugleich – zu Worte kommen. Mehr als ein indirektes sorry kommt ihm nicht über die Lippen.
Vorhang zu, alle Fragen offen. Dennoch zieht „Floodlines“ ein klares Fazit: Die verzögerte und fehlende Hilfe ist letztlich als ein Akt des Rassismus zu konstatieren. Black lives matter – but do they really?
Floodlines: Webseite und Hintergrundmaterial