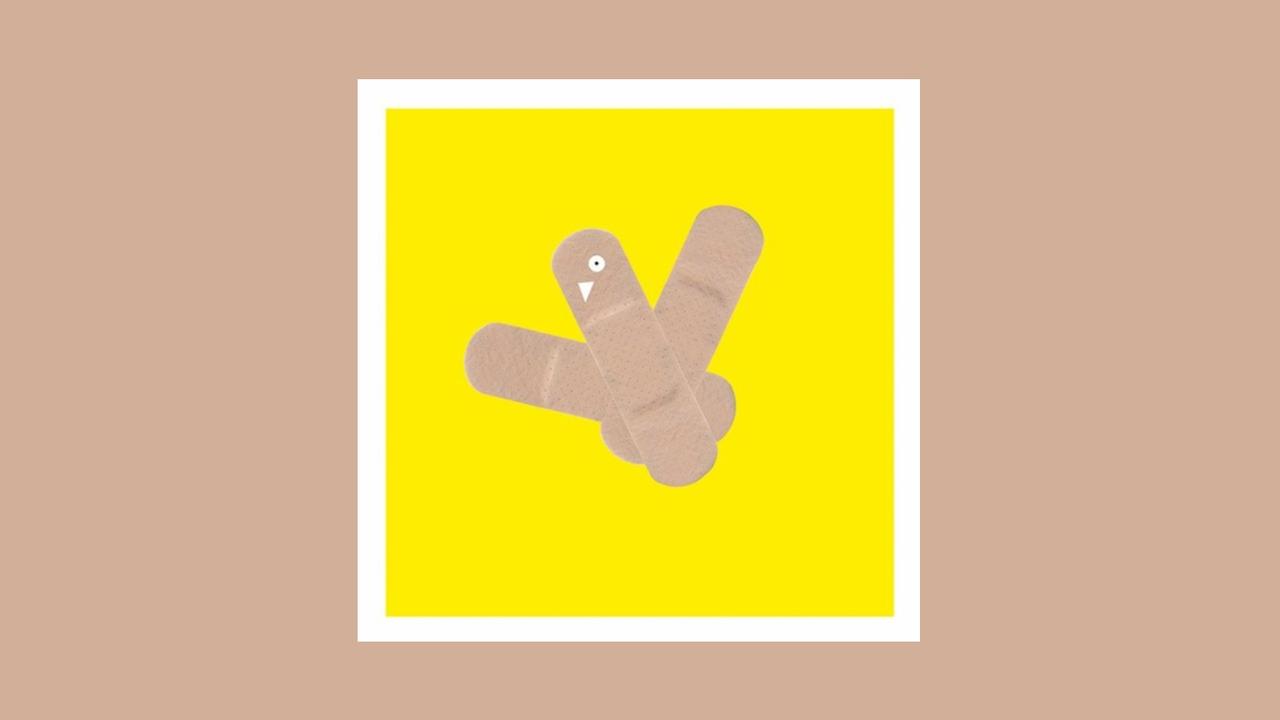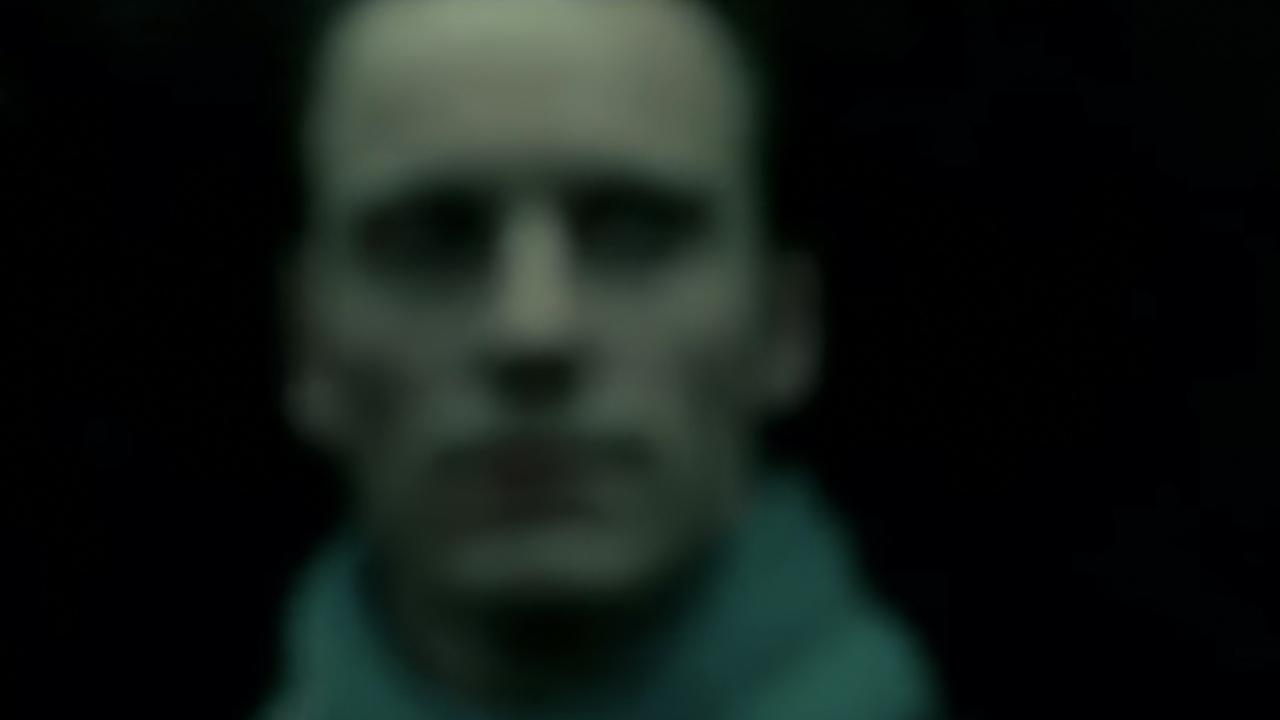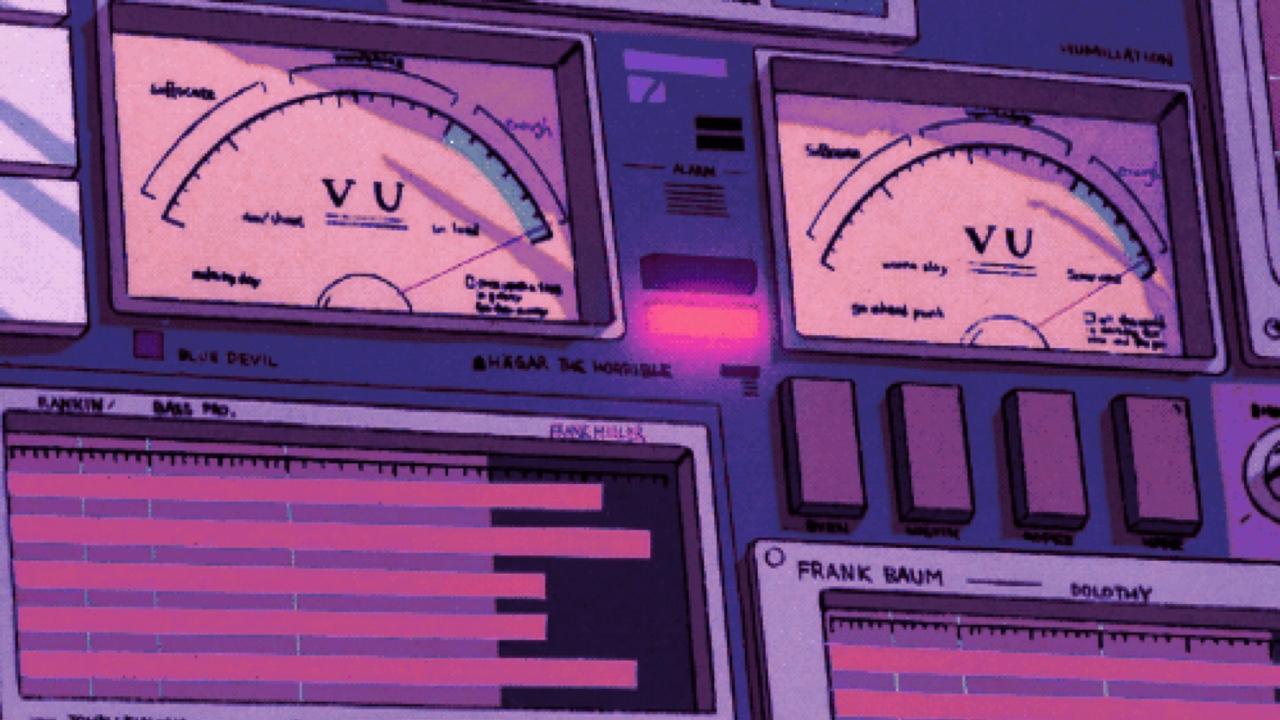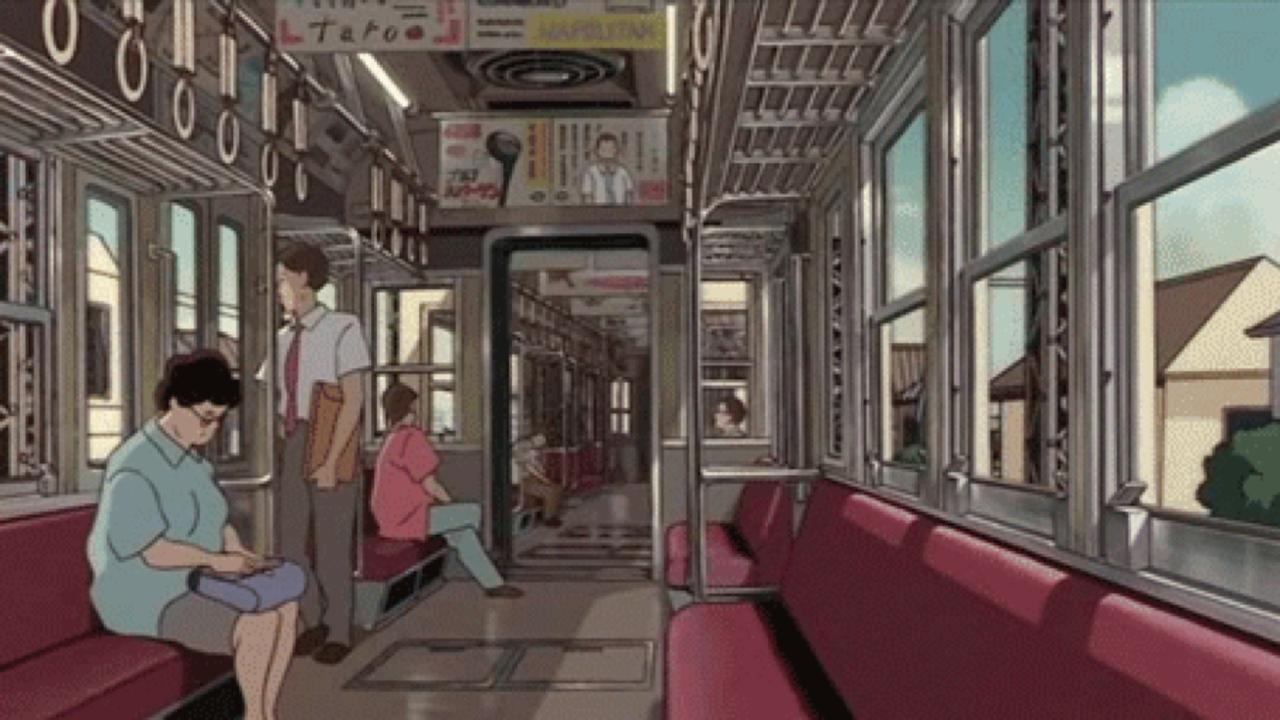„Wenn der kathartische Moment zu lange fehlt“Phillip Sollmann über Harry Partch, Kreissägen und den Stillstand der Techno-Maschine
25.5.2020 • Sounds – Interview: Ji-Hun Kim
Foto: Lendita Kashtanjeva
Phillip Sollmann aka Efdemin hat dieser Tage sein Album „Monophonie“ auf dem Label A-Ton veröffentlicht. Ein ziemlich wahnsinniges Ensemble-Projekt mit seltenen Instrumenten wie dem mikrotonalen Instrumentarium von Harry Partch, Klangskulpturen von Harry Bertoia bis hin zur fast verschollenen Doppelsirene von Hermann von Helmholtz. Laut Sollmann handelt es sich um das intensivste Projekt seiner Laufbahn. Alles begann mit einer LP-Box in New York, woraus ein langjähriges Forschungs- und Kompositionsprojekt wurde. „Monophonie“ wurde 2017 erstmalig mit dem Ensemble für Neue Musik Musikfabrik in der Volksbühne Berlin aufgeführt. Drei Jahre später erscheint nun die Arbeit als Album. Im Interview erzählt der Künstler, wie er auf dem Land der Krise strotzt, ob es seinen Beruf als DJ überhaupt noch geben wird und wie glücklich eine Kreissäge machen kann.
Sorry für die Verspätung. Ich war gerade mit meiner Familie essen und gehe jetzt in mein neues kleines Studio im Schuppen. Wie geht es dir?
Ganz gut. Und dir?
Ja, genauso. Persönlich sehr gut. Abgesehen von den schrecklichen Verwerfungen, die die derzeitige Situation mit sich bringt, genieße ich momentan sehr die Ruhe. Ich nehme das total an. Ich hatte mir ohnehin freigenommen und das ist alles irgendwie zusammengefallen. Eigentlich würde es jetzt langsam wieder losgehen. Es geht aber nicht los. Wir sind seit sieben Wochen in unserem Häuschen am See und sehen kaum jemanden, fahren einmal die Woche einkaufen. Wir kümmern uns abwechselnd um unser Kind, arbeiten in unserem neu errichteten Studio und Atelier und das ist gerade ganz toll. Ich nehme viel Musik auf mit den vielen Gitarren und Saiteninstrumenten, die ich mitgebracht habe. Vertiefe dabei Themen, für die ich zuletzt keine Zeit hatte. Auch wenn die derzeitige Situation natürlich eine Bedrohung ist, mein Beruf praktisch nicht mehr existiert (lacht).
So weit gehst du?
Kommt darauf an, was übrig bleibt und wie sich das entwickelt. Keine Ahnung, ich werde bestimmt ein Jahr lang keine Einkünfte als DJ haben. Das heißt, ich muss mir was anderes überlegen.
Mich beeindruckt, dass du überhaupt kreativ bist. Mir fiel das die vergangenen Wochen schwer.
Die ersten Wochen hatte ich schwere Depressionen. Das lag nicht nur an Corona. Aber wenn alles zum Stillstand kommt, dann kommt vieles auch zum Vorschein – Sachen, die man nie richtig verarbeitet hat. Das habe ich gefühlt überwunden und aus dieser Ruhe neue Klarheit gewonnen. Hier sind wirklich nur Rehe, Hasen und Biber – ab und zu versprengte Wutbürger, die mal angeln und ihre Dosen in den Busch schmeißen. Sonst hatte ich wenig Kontakt zur Zivilisation. Ich bin irgendwie kleiner geworden.
Kleiner?
Ich habe nicht nur abgenommen. Mein Ego wird auch kleiner. Dadurch, dass das Geratter aufhört.
Im Sinne von Demut?
Wir sind hier in der Märkischen Schweiz am See und am Wald, weit ab von allem. Nach zwei Monaten in der Natur fühlt man sich als Mensch kleiner. Ich kann das noch nicht genauer beschreiben. Aber neulich kam mir das Gefühl. Ich nehme mich selber nicht mehr so wichtig wie zuvor.
Ich war kürzlich nach sieben Wochen Kreuzberg in Brandenburg. Dort wurde erzählt, auf dem Land fallen die Disruptionen gar nicht so auf. Würde es dir schlechter gehen, wärst du jetzt im Wedding?
Ich war zweimal kurz in Berlin und fand es in der Tat ein bisschen stressig. Da muss man sich der Realität stellen und an Regeln halten. Ich habe einmal die Woche die Maske auf und bin damit der einzige Freak im Supermarkt. Die Omas und so hier denken gar nicht daran, sowas beim Einkaufen zu tragen. Die gucken einen nur an: „Ja, die Berliner! Gut, dass der ’ne Maske aufhat.“ Das ist der Vibe hier (lacht). Bleibt die Frage, wie lange das jetzt geht.

Foto: Yasmina Haddad
„Es ging doch immer um die Entgrenzung und den Kontrollverlust. Das schmerzt am meisten. Dass dieser Kontrollverlust eben völlig unmöglich ist. Das ist ja das Gegenteil der Selbstdisziplinierung. Wie lange hält ein Individuum, eine Gesellschaft ohne diese Entgrenzung aus? Ohne Fußball, ohne Club, ohne Saufen im Park.“
Wie groß sind deine Hummeln gerade?
Bei mir gibt es ja zwei Sachen. Bei der Kunst und ähnlichen Veranstaltungen mache ich mir erstmal keine so großen Sorgen. Konzerte werden irgendwann wieder stattfinden können. Ausstellungen sowieso. Das würde Sachen wie die Monheim Triennale betreffen, die abgesagt wurde, aber im nächsten Jahr nachgeholt wird. Bei Clubs sehe ich derzeit eher schwarz. Ich bin kein Virologe. Aber sich sehe, dass es keine Klarheit darüber gibt, wie und wann man das alles ansatzweise in den Griff kriegt. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Sache bald von der Politik angegangen wird. Es hat ja in dem Sinne keine Systemrelevanz. Aber es ist gefährlich, wenn es irgendwann keine Ventile mehr gibt, Dampf abzulassen. Wenn der kathartische Moment zu lange fehlt. Wenn ein Fußball-Fan nicht ins Stadion gehen kann, dann ist das nicht ungefährlich. Irgendwo muss sich das ja äußern. Dampf ablassen ist eine wichtige Funktion der Clubkultur. Wann das wieder möglich sein wird, kann ja keiner sagen. Zuallerletzt werden die Clubs wieder zum Leben erweckt werden und was dann noch übrig ist, ist eine wichtige Frage. Gerade die spannenden Strukturen, die unterkommerzialisiert sind, werden darunter leiden.
Berlin spielte dabei schon immer eine besondere Rolle.
Ich glaube, dass viel von dem, was spannend ist, weg sein wird. Vielleicht entsteht dadurch was Neues. Ich habe viel drüber nachgedacht, inwiefern sich die Musik ändern wird. Da, wo wir zuletzt waren, in einer fast zynischen Situation, wo man eigentlich unglaublichen Trash ernstgenommen hat. Sei es 90er-Hardtrance, der aus fast jedem Lautsprecher quoll. Da muss man sich fragen, ob das danach je wieder jemanden interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass alles wieder ein bisschen feiner wird und einige Positionen danach nicht mehr vertretbar sind. Auch in der Kunst. Da wird es spannend sein, wer danach vielleicht gar nicht mehr existiert. Positionen zwischen den Stühlen, wie ich sie vertrete, die auch mal was Handbremsiges haben, werden bestimmt als erstes wegrationalisiert. Weil sowas keiner braucht.
Jens Balzer hatte geschrieben, dass Clubs oder Live-Venues so aussehen könnten wie ein Bentham’sches Panoptikum. So einen Club müsste man erst bauen. So viele Gasometer gibt es in Berlin nicht mehr.
Das interessiert doch auch keinen. Es ging doch immer um die Entgrenzung und den Kontrollverlust. Das schmerzt am meisten. Dass dieser Kontrollverlust eben völlig unmöglich ist. Das ist ja das Gegenteil der Selbstdisziplinierung. Wie lange hält ein Individuum, eine Gesellschaft ohne diese Entgrenzung aus? Ohne Fußball, ohne Club, ohne Saufen im Park. Das sind wichtige Elemente, die eine Gesellschaft am Laufen halten. Vielleicht gibt es einen Backlash und eine Rückkehr zu einer gemeinschaftlicheren Idee, was mich freuen würde.
Die Utopie einer neuen Regionalisierung? Wieder mehr Residents und lokale Kulturen wie damals im Jugendzentrum?
(Lacht) Das gute alte Jugendzentrum. Aber klar, war doch super. Ich komme jetzt erst langsam dazu, mir darüber Gedanken zu machen. Die letzten Monate waren für mich wie gesagt selbst-isoliert. Ich habe das meiste ausgeblendet und mich Konzepten gewidmet, für die ich zuvor keine Zeit und Ruhe hatte. Für die ich auch keine ökonomische Funktion gesehen habe. Das ist toll gerade. Langsam schleicht sich die Erkenntnis ein, dass wir uns was überlegen müssen und ich bin hin und her gerissen, vielleicht doch in der Filmindustrie anzuheuern oder meine Tischler-Karriere in ein neues Berufsfeld umzusetzen. In Frankreich gab es schon immer ein anderes Ferienkonzept. Die große lange Pause, die das gesamte Land gemeinsam macht. Ein befreundeter Künstler aus Frankreich meinte oft zu mir, dass er sich das wie in Deutschland mit diesen zerstückelten Ferien nicht vorstellen kann. Ihm sei diese lange Pause so wichtig, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Da ist jedes Jahr Klausur, um neue Positionen entwickeln zu können. Das habe ich irgendwann wirklich verstanden. Jetzt bin ich unfreiweillig in dem Sabbatical, das ich mir vorher nie zugestanden habe. Wovon ich aber immer geträumt habe. Aber dann ist die Techno-Maschine immer weiter gerattert. Brasilien, Japan, zack zack, unbedingt, muss man ja mitnehmen. Keine Luft holen, zwischendurch ein Kind gekriegt und um alles am Laufen zu halten, macht man weiter. Bis die Midlife-Crisis kommt. Es gab immer weniger Zeit und immer weniger Ruhe.
Wir haben über die Clubkultur gesprochen. Was passiert aber mit dem DJ?
Den Beruf, den ich über viele Jahre weitestgehend ausgeübt habe, gibt es momentan nicht mehr. Ich denke nicht, dass er in der Form, wie er die letzten Jahre bestand, zurückkommen wird. Ich glaube auch nicht, dass es das Geld dafür geben wird. Es wird alles irgendwie kleiner, intimer vielleicht? Oder nur noch Stars? Ich warte ab, es macht da nicht viel Sinn zu spekulieren. Aber ich genieße die Pause, auch nicht so viel Zeit in Flughäfen zu verbringen. Das erste Mal seit zehn Jahren war ich jeden Tag vor zwölf im Bett. Allein das fühlt sich schon so anders an. Ein bisschen krass. Da kommt gedanklich viel in Bewegung: Was man als Status Quo akzeptiert und sich selbst angetan hat. Natürlich mit viel Dankbarkeit für all die Jahre des Supports und dass ich das überhaupt so lange machen konnte. Das war ein tolles Leben. Aber vielleicht habe ich in zwei Jahren ein ganz anderes Leben. Weil es das vielleicht nicht mehr so gibt und vielleicht, weil ich das in der Form auch gar nicht unbedingt zurück will. Ich bin das Blatt auf dem Wasser, das durch den Wind hin und her getrieben wird und ich schau, wohin mich dieser Wind treibt. Es gibt viele offene Enden. „Monophonie“ ist ein Beispiel dafür, dass ich mich nicht nur in Clubs wohlgefühlt habe. Dieses Jahr habe ich noch zwei größere Ausstellungen mit dem Modular Organ System. Monheim wurde aufs nächste Jahr verschoben. Das sind drei große Projekte mit größerem Budget und Umfang. Das macht Spaß und gerade jetzt im Moment der Corona-Krise gab es positive Entscheidungen für zwei Ausstellungen. Das ist auch ein Grund, wieso ich nicht so sorgenvoll denke, wie jemand, der nur vom Auflegen lebt und nur das hatte. Außerdem habe ich mir eine Kreissäge gekauft und kann jetzt echt gut tischlern (lacht).
Konntest du das schon immer?
Konnte ich schon immer. Aber jetzt kam die Kreissäge dazu.
So ein Hightech-Ding? Mit tollen Sicherheitsfeatures?
Ja! Ich dachte immer, man könne sich alles nur zusägen lassen. Aber mit einer Kreissäge ist das total super. Das wollte ich schon immer haben. Hier wurde alles neu gebaut. Wir leben hier gerade in einer supertollen Umgebung. Sehr einfach, aber funktional. Wir haben Hochbeete gebaut und bestellt. Den Kompost umgesetzt, ich bin weit weg.
Man hat von anderen Berlinern gehört, die es sich in Brandenburg oder MV gemütlich machen wollten, dass die mit ganz schönen Anfeindungen bis hin zu aufgeschlitzten Autoreifen zu tun hatten.
Wir haben keinen Kontakt. Brandenburger wissen mittlerweile, dass sie mit Berlinern zu tun haben und auch, wie wichtig wir sind als Klientel im Baumarkt und so. Die leben ja von den Leuten, die hier Teilzeit leben …
… und teure Kreissägen kaufen.
Genau.

Phillip Sollmann „Monophonie“ ist auf A-Ton erschienen.
Lass uns über dein Album „Monophonie“ sprechen. Ein Projekt, das du jetzt seit Jahren betreust.
Ende der Neunziger habe ich die LP-Box „Instruments of Harry Partch“ in New York gefunden. Ich war extrem begeistert von den Klängen, die diese Instrumente erzeugen konnten. Ich habe mich immer wieder in diese Welt vertieft. Das führte dazu, dass ich den Wunsch hatte, selber mit solchen Instrumenten zu arbeiten. Ich schätze zwar die Musik, die Partch komponiert hat. Aber sie ist sehr im Musiktheater verhaftet. Es gibt Narrative, es wird viel mit Gesang gearbeitet. Ich hatte immer den Wunsch, mit den Instrumenten als Sounds und Klangapparat zu arbeiten. Um damit auch was anderes zu machen und den repetitionsfokussierten Ansatz einzubringen. Dank der Inszenierung von Harry Partchs „‚A Ritual of Dream & Delusion“ durch Heiner Goebbels auf der Ruhrtriennale 2013, hatte ich die Möglichkeit, die Instrumente als Repliken beim Ensemble Musikfabrik zu hören, und bin danach zu denen gegangen und habe gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir zu arbeiten. Dann haben wir uns einen Kompositionsauftrag geschaffen mit Hilfe von Martin Hosbach. Wir haben am HKF einen Antrag gestellt, der uns zugesprochen wurde. So hatte ich das Budget, ein Jahr lang mit dem Ensemble Musikfabrik vor Ort an den Instrumenten zu arbeiten. Viel haben wir improvisiert erarbeitet. Wir haben akkurate Sample-Versionen von den Instrumenten als virtuelle Instrumente erstellt. Mit denen konnte ich wiederum in meiner normalen Umgebung arbeiten.
Normale Arbeit?
Verschiedene Sequencer und Programmierumgebungen. Das beinhaltete eine Auseinandersetzung mit Mikrotonalität und der speziellen Stimmung, die Partch benutzt. Er benutzt viele Töne in einer Oktave als Möglichkeitsraum. Das sind 43 Töne statt zwölf. Das heißt, man kann sehr feine Nuancen und sehr reine Stimmungen erzeugen, die in den Obertonspektren total intensiv wirken. Da habe ich mich mit Hilfe von Robin Hayward, der mein Lehrer war, und Konrad Sprenger immer weiter in die Welt hineinbegeben. So ist die Musik entstanden. Das hat wenig mit der Musik zu tun, die Harry Partch gemacht hat. Der Klangapparat wurde durch zwei Positionen erweitert. Zum einen die von Harry Bertoia. Bertoia ist vielen als Designer für Knoll bekannt, er hat aber auch an Klangskulpturen gearbeitet. Bei seinem Sohn habe ich Zeit in seiner Scheune, in der die Arbeiten untergebracht sind, verbracht und durfte mir einige Skulpturen aussuchen, die nach Europa kamen. Die dritte Position ist der Physiologe Hermann von Helmholtz, der in Berlin gewirkt hat und die tolle Doppelsirene erfunden hat, um damit akustische und physiologische Phänomene zu erforschen und zu beweisen. Das ist der Rückschluss zu Partch. Helmholtz war ebenfalls Anhänger der Just Intonation. Er bedauerte den Siegeszug der gleich schwebenden Stimmung, so wie wir sie heute vom Klavier kennen. Helmholtz’ Sirene habe ich durch lange Recherchen in den hintersten Kellern der Charité gefunden. Mit Hilfe eines ganz tollen Hausmeisters, der sie gerettet hat. Sie war völlig verstaubt. Ich wurde von dem Institut für Physiologie sehr freundlich behandelt. Und bis heute steht mir die Doppelsirene als Leihgabe zur Verfügung und im Finale der Aufführung wird mit der Sirene über das Velvet-Underground-artige Eintonstück gejammt. Das hat eine ganz andere Qualität reingebracht. Ich fand das ziemlich lustig, weil ich da auch mitgespielt habe.

Wuchtig. So sah der Bühnenaufbau auf der Ruhrtriennale 2017 aus. Foto: Volker Beushausen
Ganz schön viel Holz.
Bei dem Stück ging es mir darum, verschiedene transatlantische Positionen zusammen zu bringen. Vor allem ging es darum, gerade bei meinem Background, auf der Bühne keinen Computer zu benutzen, keinen Sync zu haben, auch keinen Dirigenten. Sondern dahin zu kommen, dass sich das Ensemble selbst als Organismus versteht. Das hat auch die meiste Zeit verbraucht. Sie waren gar nicht gewöhnt, mit einer sehr auf Rhythmus fokussierten Musik zu arbeiten. Ganz akkurat zu spielen. Sie sind ein absolut geniales Ensemble für Neue Musik. Da geht es eigentlich um andere Qualitäten und das war hochgradig spannend. Erst war ich total entsetzt, dass der Groove gar nicht möglich schien. Wir sind aber mit jeder Aufführung ein Stück weiter gekommen. Es wurde immer besser. Aus den letzten Aufführungen habe ich viele Spuren übernommen für das sehr hybride Album-Projekt, das im Studio produzierte, virtuelle Anteile hat, aber auch Live-Spuren mit den Originalinstrumenten. Das war ein immenses Volumen an Aufnahmen, die ich erstmal sortieren musste. Daraus über Weihnachten und Silvester diese endgültige Version für eine Schallplatte zu machen, war gar nicht so einfach. Ich wurde auch ein bisschen überredet, das rauszubringen. Das war erstmal gar nicht meine Idee.
Da liegen paar Jahre dazwischen.
Genau. Februar 2017 gab es die erste Aufführung. Das ist drei Jahre her. Beim Hören hatte ich das Gefühl, dass es eine Qualität hat, die es rechtfertigt, herausgebracht zu werden. Und ich hoffe, dass es den Hörern auch so geht.
Wir machen weiter nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
Scheiße, ist ja gar kein Radio-Interview (lacht). Alles klar.
Du meintest, dass es schwer war, einen Groove zu entwickeln. Woran lag das deiner Meinung nach?
Das ist in der Neuen Musik nicht vorgesehen. Da gibt es kaum Komponisten, die auf diesen Bereich der Musik überhaupt abheben. Als klassisches Ensemble spielen sie ja sonst auch Bratsche, Geige, Klavier, Schlagzeug. Als Partch-Instrumentalisten spielen sie aber ganz andere Instrumente. Die wurden erst mit der Zeit neu gelernt. Musikfabrik ist das einzige Ensemble in Europa, das diese Instrumente überhaupt spielen und die Noten dazu lesen kann. Das ist verklausuliert. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Das war eine der großartigsten Erfahrungen für mich. Im Nachhinein würde ich bestimmt einige Sachen anders machen. Dafür bin ich aber zufrieden. Es wäre mit einem Klick einfacher gewesen, das wäre schneller gegangen. Aber das Ergebnis wäre auch ein anderes geworden. Dann wäre es nur das nächste Crossover-Projekt „Electronic producer goes classic“ geworden. Wo dann schäbig einfach eine Kickdrum druntergelegt wird. Das war nicht mein Anspruch. Ich hoffe, dass sich das beim Hören klärt. Es war komplex. Mit der sehr speziellen Stimmung, den sehr speziellen Instrumenten. Das hat mit Techno nichts zu tun. Das Projekt ist in sich eigentlich sehr geschlossen. Natürlich spielt meine Person als Komponist da mit rein und es werden viele Brücken geschlagen. Das will aber nichts konkret mit dem Club zu tun haben.

Foto: Volker Beushausen
Gibt es so etwas wie eine internationale Partch-Szene?
Um 2008 habe ich schon mal den Versuch gestartet, mit dem in den USA ansässigen Partch Ensemble diese Idee in die Wege zu leiten. Das wurde sehr eindeutig abgelehnt. Ich bin mir nicht sicher, wie die meine Interpretation wahrnehmen. Es gab immer wieder Partch-Instrumente, die irgendwo auftauchten. Paul Simon hat vor paar Jahren eine Platte rausgebracht. Tom Waits hat auch mit den Instrumenten gearbeitet. Es gab Kontakt zu zwei Leuten, die in der Partch-Forschung sind und die waren eher positiv überrascht und haben sich gefreut, dass es aus anderen Welten Interesse gibt. Weil es eine käsige, kleine Welt ist, um die sich alles dreht. Da wird alles immer nur originalgetreu aufgeführt und interpretiert. Das wäre Harry Partch auch mega auf die Nerven gegangen. Er hatte mal geschrieben, dass alle Instrumente nach seinem Tod verbrannt werden sollten. Er war ein extrem launischer Saufbold, dennoch ein super Typ. Im Partch-Archiv – da war ich eine Woche in der Nähe von Chicago – habe ich so viel Material gesammelt, da könnte man noch mal ein eigenes Buch machen. Im Vorfeld der ganzen Arbeit habe ich viel recherchiert. Das war großartig, weil ich sehr tief mich in die Welt hineinbegeben und auch geguckt habe, ob ich das überhaupt darf. Dann war mir aber auch klar, dass es gut ist, wenn man es updatet. Dass es gut ist, wenn man die Instrumente auf neue Möglichkeiten befragt. Als die Platte dann fertig war, war das eine Art Erlösung.
Dein größtes Projekt?
Das war das intensivste Projekt, an dem ich bis jetzt gearbeitet habe. Danach war ich ziemlich ausgelaugt. Parallel habe ich versucht, meine DJ-Karriere aufrecht zu halten, was auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das war absurd. Da war ich erst einen Tag im Partch-Archiv. Am nächsten Tag in Pennsylvania in der Scheune von Harry Bertoia und zwei Tage später in Montreal im Stereo am Raven. Teilweise war das too much. Körper und Geist brauchen eine Zeit, um sich an Umstände zu gewöhnen. War aber auch schön, das zusammen machen zu können. Recherche und das DJ-Leben.
Du setzt dich schon länger mit dem Bereich Mikrotonalität auseinander. Auch bei deiner Orgel spielt das Thema eine wichtige Rolle. Was lernt man aus dieser Auseinandersetzung? Braucht die Welt mehr Mikrotonalität?
Ich glaube, dass die Welt mikrotonaler wird. Dass es ein starkes Interesse aus allen möglichen Ecken gibt. Ich bin nur ein Beispiel davon. Ich bin gefühlt noch immer sehr am Anfang. Hier in meinem Schuppen geht es gerade nur um Mikrotonalität. Ich habe meine alten Max-Patches wieder rausgeholt, höre stundenlang Sinustöne und Schwebungen. Ich glaube, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist. Bei unserer Orgel geht es zentral um Mikrotonalität und die Obertonreihen in ihrer Intensität. Da wurde für mich eine neue Intensität der Musikerfahrung aufgemacht. Es gibt heute ganz viel Musik, die ich gar nicht mehr hören kann. Wo sie stark moduliert und arg im Harmonischen verhaftet ist und wo so viel erzählt wird. Mir geht es eher um die Stimmung als Funktion in der Zeit. Das ist mir näher und ich kann mir stundenlang eine gute Stimmung anhören. Eine, die überhaupt nicht tot ist und durch die Bewegung meines Kopfes ein extrem lebhafter Organismus wird, an dem ich einzelne Veränderungen vornehmen kann. Auf der Platte gibt es Stücke, da gibt es nur zwei Akkorde, die sind aber tatsächlich sauber gestimmt. Ich mag das gerne, diese gewisse Ruhe. Das hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun.
Jetzt geht das schon wieder los.
(Lacht laut) In Klammern „lacht“. Für mich ist das ein Thema, bei dem ich noch ganz am Anfang stehe. Das bleibt irgendwie. Man kommt schlecht wieder zurück. Wenn ich die Gitarre im herkömmlichen Sinne stimme, dann ist das schwierig. Da habe ich fast nur Quinten und Oktaven momentan. Ich versuche mich in dem Bereich interessant zu bewegen. Mal gucken, wohin mich das führt.