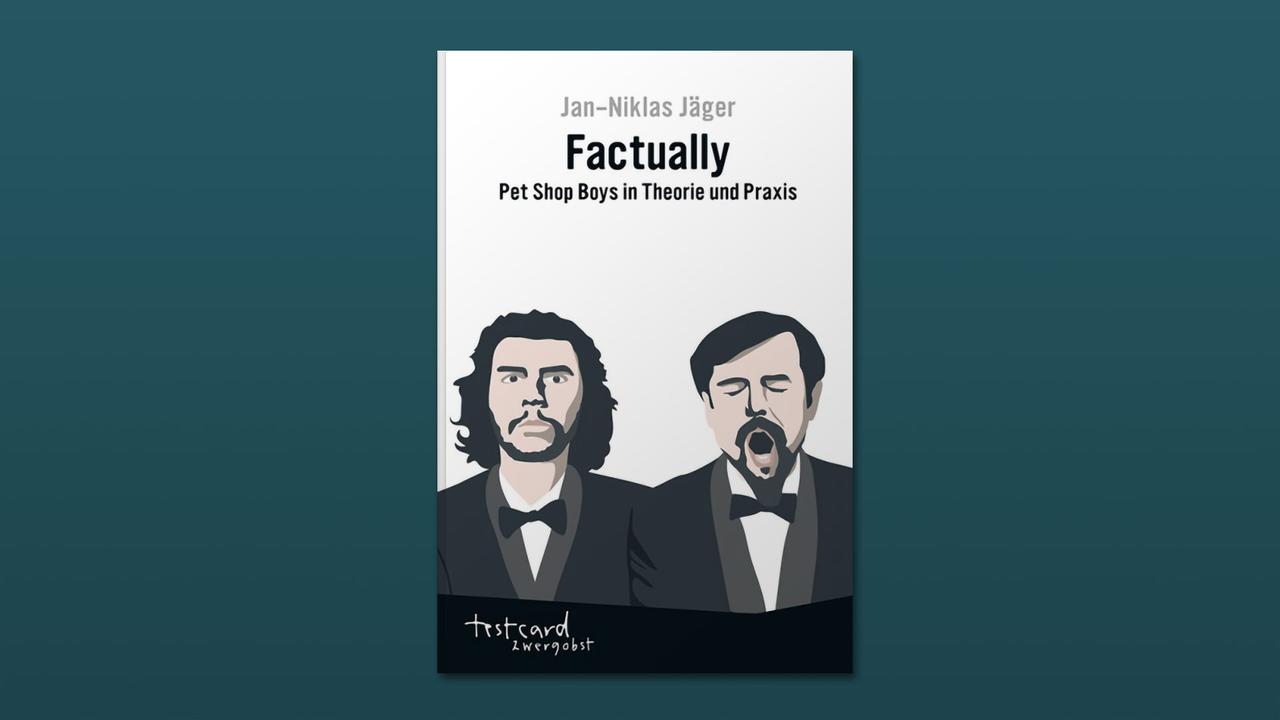Pageturner: Literatur im Juli 2019Ian McEwan, Sophie Wennerscheid und Lev Manovich
4.7.2019 • Kultur – Text: Frank Eckert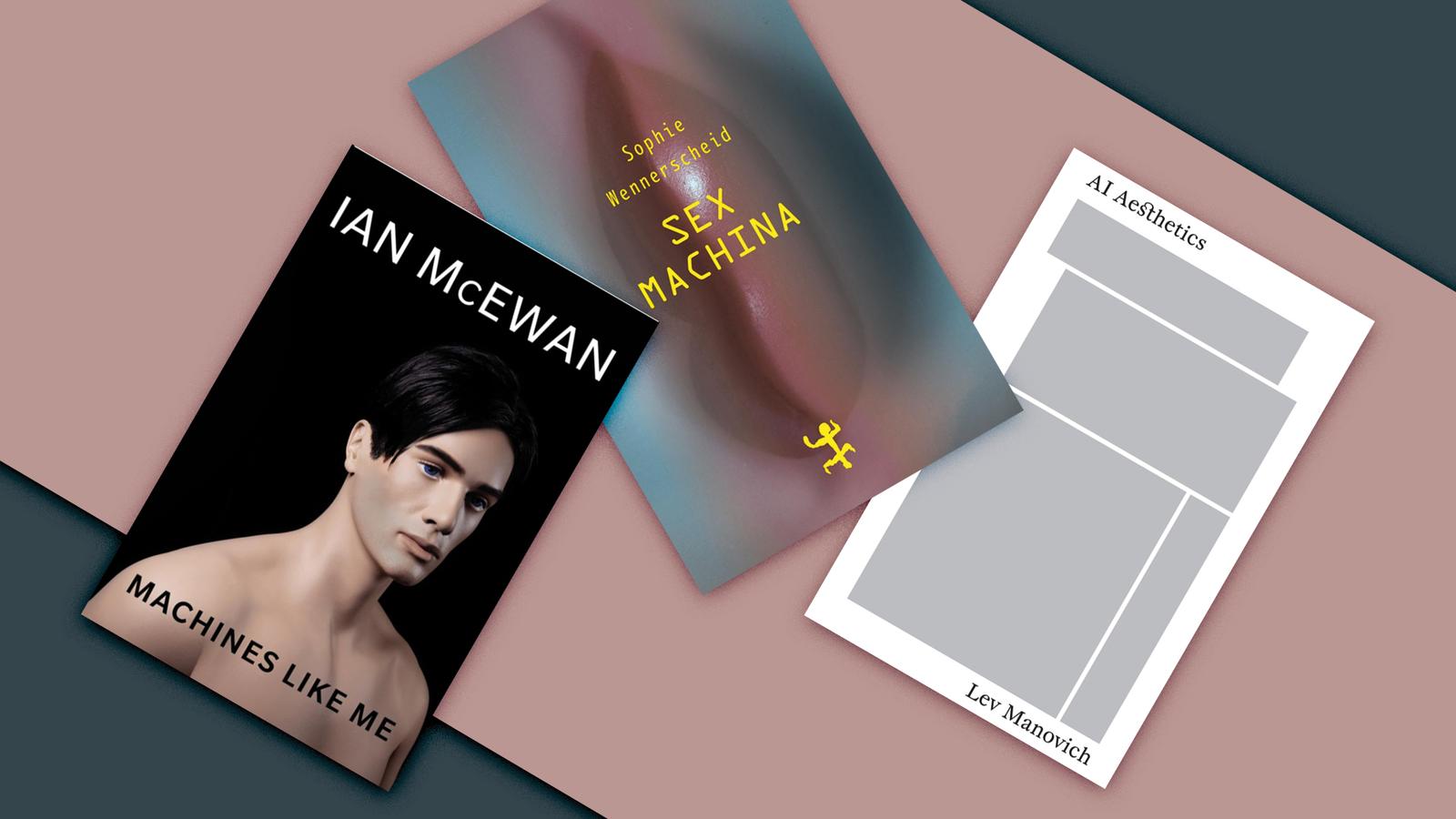
Wer schreibt, der bleibt. Das gilt vor allem dann, wenn das Geschriebene auch gelesen, bewertet und eingeordnet wird. In seiner Kolumne macht Frank Eckert genau das: Er ist unser Pageturner. Das können dringliche Analysen zum Zeitgeschehen sein, aber auch belletristische Entdeckungen – relevant sind die Bücher immer. Im Juli dreht sich alles um die Künstliche Intelligenz. Der große britische Romancier Ian McEwan konstruiert dafür ein Paralleluniversum seines Heimatlandes, in dem Alan Turing noch lebt und als Nationalheld die technischen Strippen zieht. Wer es sich leisten kann, öffnet seine heimischen vier Wände für die KI. Die Kulturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid fragt derweil in „Sex Machina“, wie sich neue Technologien auf unser aller Begehren auswirken. Und der russisch-amerikanische Computerwissenschaftler Lev Manovich wandelt auf den Pfaden Ada Lovelaces und untersucht, welche Auswirkungen unser Verhältnis zur KI und zu Algorithmen auf die Ästhetik hat.

Machines Like Me (Affiliate-Link) | Maschinen wie ich (Affiliate-Link)
Ian McEwan – Machines Like Me (Jonathan Cape)
Der Traum von der Künstlichen Intelligenz und vom künstlichen Menschen befeuert gerade eine Menge Utopien und Dystopien, Fiktion und Sachbücher, Filme, Serien und Kunstwerke. Der altvordere britische Autor Ian McEwan wollte da offenbar nicht hintanstehen. In einer Parallelvergangenheit sind Machine Learning, Künstliche Intelligenz und menschennahe Robotik bereits seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts Realität und in den Achtzigern auch kommerziell erhältlich, zumindest für die Wenigen, die sich die noch restriktiv verpreisten Adams und Eves leisten können. Zu verdanken ist das Alan Turing, der in diesem Parallel-Großbritannien nicht via „homosexual act“ in den Selbstmord getrieben wurde, sondern als offen schwuler Kriegsheld einen Einstein-/da-Vinci-artigen Status als Universalgenie genießt.
Der von Ennui geplagte Steueranwalt und Privatier Charlie möchte einmal im Leben „early adopter“ sein und kauft sich von seinem Erbe spontan ein Adam-Modell (die Eves waren schon alle weg) – als Spielzeug, Studienobjekt und um mit ihm Geld an der Börse zu machen. Mit seiner deutlich jüngeren, distanzierten Freundin Miranda trainiert er Adams synthetisches Bewusstsein. Das erste Unbehagen am zu menschennahen Roboter, der genau im „Uncanny Valley“ des zu Ähnlichen aber doch noch leicht Andersartigen liegt, weicht schnell der Gewöhnung – was auch Sophe Wennerscheid in „Sex Machina“ angemerkt hat, und die diesbezüglich „voll funktionalen“ Körperteile Adams kommen auch zum Einsatz. Als Adam dann tatsächlich einen eigenen Willen und eigene Emotionen entwickelt und sich einen Handlungsspielraum jenseits der Roboter-/Sklaven-Regeln herausnimmt, gerät das Leben aller beteiligten komplizierter als gedacht. Dazu spielen noch Geschichten aus Mirandas Vergangenheit und Gegenwart (eine Vergewaltigung, eine mögliche Adoption) in die Dreierbeziehung hinein.
Worin das Problem dieses Romans bereits anklingt. Ab dem zweiten Drittel franst die Geschichte unnötig aus, gegen Ende scheint es sogar, als hätte McEwan das Interesse an seinem Hauptthema verloren. Stattdessen wird die Charlie-Miranda-Beziehung ausdiskutiert und geschichtliche Details der Parallelwelt ausgebreitet. Letztere allerdings mit einigen hübschen Ideen, etwa dass Großbritannien den Falkland-Krieg verliert und Thatcher daraufhin zurücktreten muss, dass die Beatles als alternde Revivalband ihrer selbst auftreten und vieles mehr. Also ein typischer McEwan-Roman, der nie wirklich schlecht geschrieben ist, meist clever und mitteilsam daherkommt und mich dann doch etwas ratlos und frustriert zurücklässt. Ian McEwan ist nur dann richtig gut, wenn er es schafft, sich auf ein Thema zu konzentrieren (wie zuletzt in „The Children Act“). Hier aber hat er ein – zumindest für mich – hochspannendes Thema ohne Not einfach verschenkt. Der Roman fällt sowohl vom Reflexionsgrad wie auch vom Spannungsbogen hinter Serien wie „Real Humans“, die die sehr offensichtliche Vorlage für Adam lieferte, oder „Westworld“ zurück. Hinter die zeitgenössische Speculative Fiction etwa von Maureen McHugh oder Sarah Pinsker sowieso. Schade, denn McEwan kann schreiben und hätte aus dem Thema so viel mehr herausholen können als ein mediokres Familienmelodram.
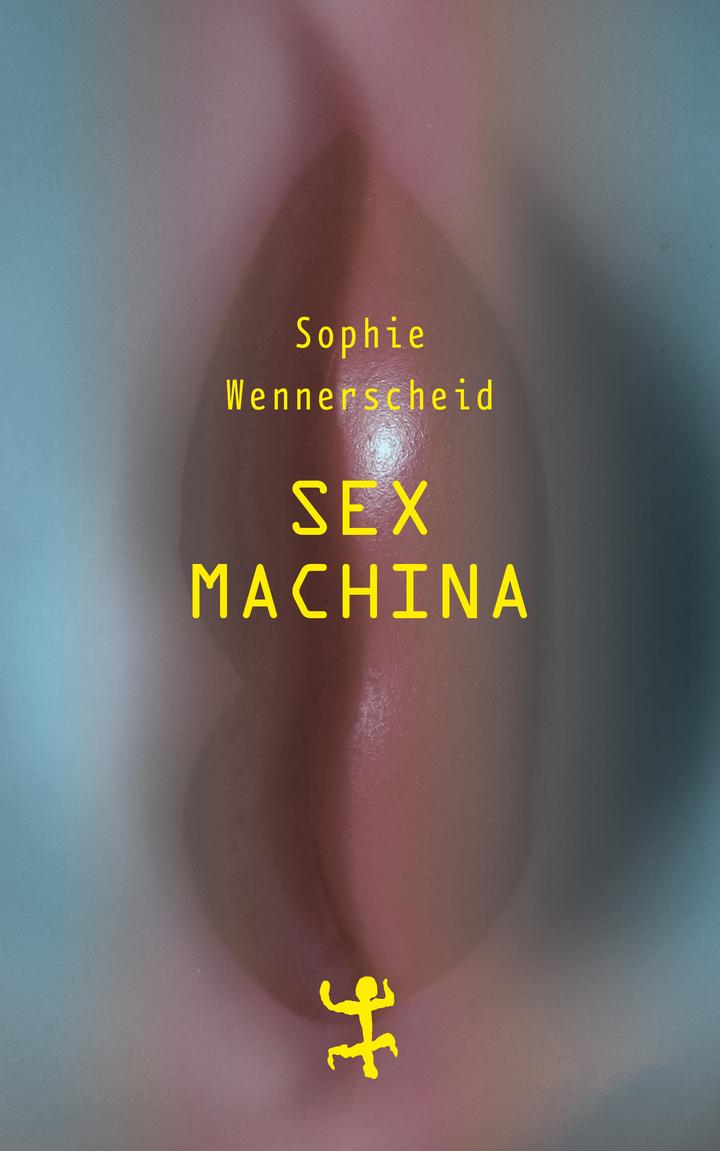
Sex Machina (Affiliate-Link)
Sophie Wennerscheid – Sex Machina (Matthes & Seitz)
Wie wirken eigentlich neue Technologien auf unser aller Begehren? Also zum Beispiel analoge somatische Techniken wie hormonelle Geburtenkontrolle und In-vitro-Fertilisation, sowie digitale Technologien von Virtual Reality (VR) über Robotik und Künstlicher Intelligenz (AI) zu Sozialen Netzwerken und ihren Wirkungen auf Psyche und Körper? Die Berliner Skandinavistin und Filmwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid folgt den Spuren der Technologie dort, wo das Wesen des Menschen klassischer Weise am verschlossensten und intimsten, aber auch am mächtigsten und unmittelbarsten offenbar ist, nämlich in der Sexualität (in der Reproduktion) und im Begehren (in der Erotik). Ihre Guides in diesem unübersichtlichen Territorium sind Karen Barad, deren Agentielle Theorie die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Mensch, Tier und Ding aufweicht und verkompliziert. Sowie Donna Haraway, deren Motto „Make Kin, not Babies“ eine neue Fluchtlinie des Begehrens vorschlägt, die eine grundlegende Verqueerung und Gemeinschaftswerdung (Hybridisierung) von Mensch und Maschine und Tier und Pflanze ermöglicht – als Gegenmodell etwa zum Bild des Cyborg als hypermaskuline Mensch-Maschine, als Kriegsapparat. Es geht also um eine Grenzen aufweichende Vermischung und Mitfühlung von Mensch, Technik und anderen Leuten. Eine Vermischung, die durchaus unheimlich, monströs und obszön sein kann.
Wie Wennerscheid an zahlreichen Beispielen aus Film zeigen kann (z.B. der tolle „Ex Machina“, der auch als ironische Vorlage für den Buchtitel diente, Serien wie „Westworld“ und „Real Humans“ natürlich ebenso), Technik (Hiroshi Ishiguros lebensnahe Roboterkopie tief im „Uncanny Valley“ des verstörend ähnlich-gleichen), Kunst (Michaela Meliáns „Electric Ladyland“) und Musik (Chris Cunninghams visionäres Video zu Björks „All is Full of Love“), sind die Ideen und Versuche hin zu anderen Sexualitäten nicht von den bisher dominanten Macht und Reproduktions-Modellen und -Phantasien angetrieben. Diese sind fast immer verstörend oder kinky, gewinnen aber schon heute zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz, zumindest in bestimmten Milieus. Das Inhumane im Menschen bleibt aber immer eine Herausforderung, erfordert und ermöglicht eine Konfrontation mit dem Selbstbild. In einer Multispezies-Assemblage aus Menschen, Cyborgs, Robotern und AI, wo ist da der Platz des Subjektes? Solche Fragen zu stellen helfen sogar Sextoys. Und diese spannende, hochinteressante Studie.
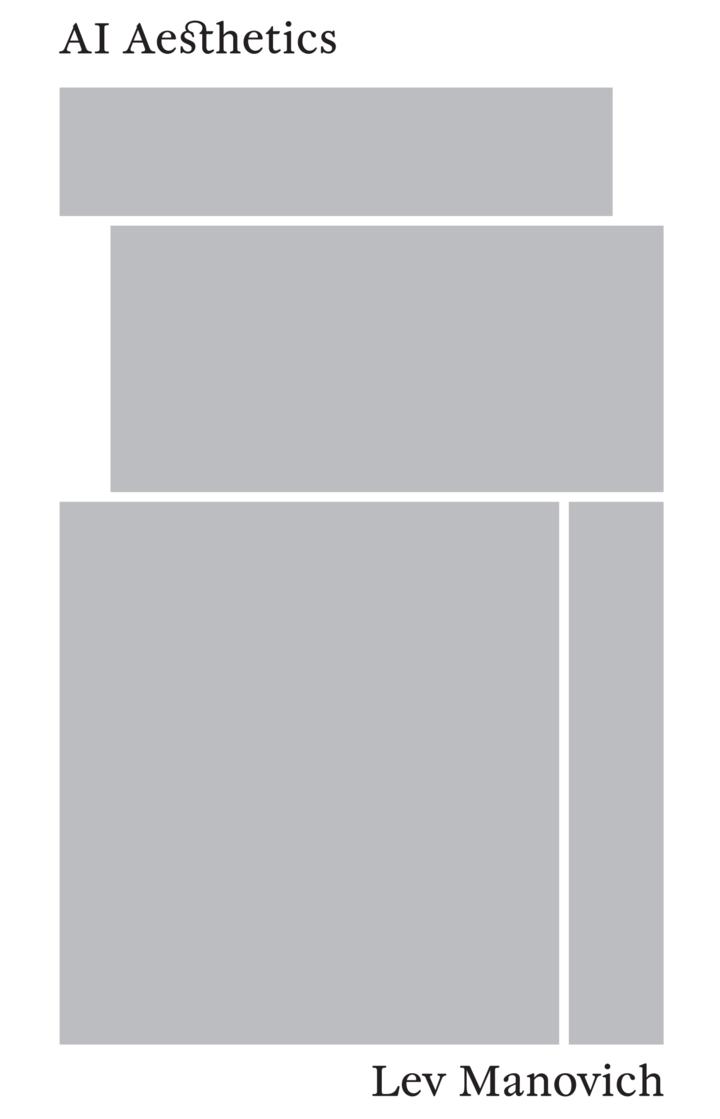
AI Aesthetics (Affiliate-Link / Ebook)
Lev Manovich – AI Aesthetics (Strelka Press)
Ada Lovelace, „erste Programmiererin“ und konzeptuelle Wegbereiterin der modernen Digitaltechnik, hat bereits 1842 die Ästhetik, spezifisch Musik und Komposition, als eine der wichtigsten Konsequenzen der von ihr entwickelten algorithmischen Methode und Denkweise identifiziert. Der russisch-amerikanische Computerwissenschaftler Lev Manovich greift im Essay „AI Aesthtetics“ Lovelaces Intuition auf und untersucht, inwieweit Algorithmen, Machine Learning und Künstliche Intelligenz (AI) bereits in Hoch- und Alltagskultur eingeschrieben sind. Damit schreibt Manovich auch die materialistische Medientheorie von Friedrich Kittler fort, nämlich dass das, was wir wissen können, wesentlich von den Kulturtechniken abhängt, die wir nutzen. Wenn sich AI also rudimentär als automatisiertes Denken (oder etwas profaner als maschinelle Mustererkennung) begreift, dann ist klar, dass eine höhere Form von Kognition, die dem menschlichen Denken vergleichbar oder überlegen sein soll, zwingend auch in Ästhetik eingreifen muss – und umgekehrt von ihr definiert wird. Manovich geht es um Ersteres. Zum Beispiel: Wie wird ästhetische Vielfalt, etwa auf Instagram und YouTube, von Algorithmen erzeugt und gesteuert? Wie wirken die Empfehlungen und Verbindungen innerhalb der Plattformen auf das ästhetische Empfinden besonders von unerfahrenen Usern zurück? Führt die Verteilung ästhetischer Urteile und Vorlieben rund um die Welt zu mehr Diversität oder zu einer globalen Homogensierung, bei wem, für wen? Die Antworten auf diese und verwandte komplexe Fragestellungen bleiben offen. Klar ist nur, wie fundamental und unumkehrbar dieser Eingriff schon jetzt ist. Manovich gibt eine Reihe instruktiver Beispiele von „Game of Thrones“ zu zeitgenössischer Kunst, von Spotify zu Yelp. Oder wie im Begriff der „Diversity“ aus Unterschieden und Differenz ein finanziell ausbeutbarer Aktivposten der algorithmischen Kultur wurde. Nicht das allen Gemeinsame schöpft heute Wert, sondern die kleinen Unterschiede. Diese Entwicklung besser zu verstehen und zu steuern, ist die große verbleibende Aufgabe für das menschliche Denken.