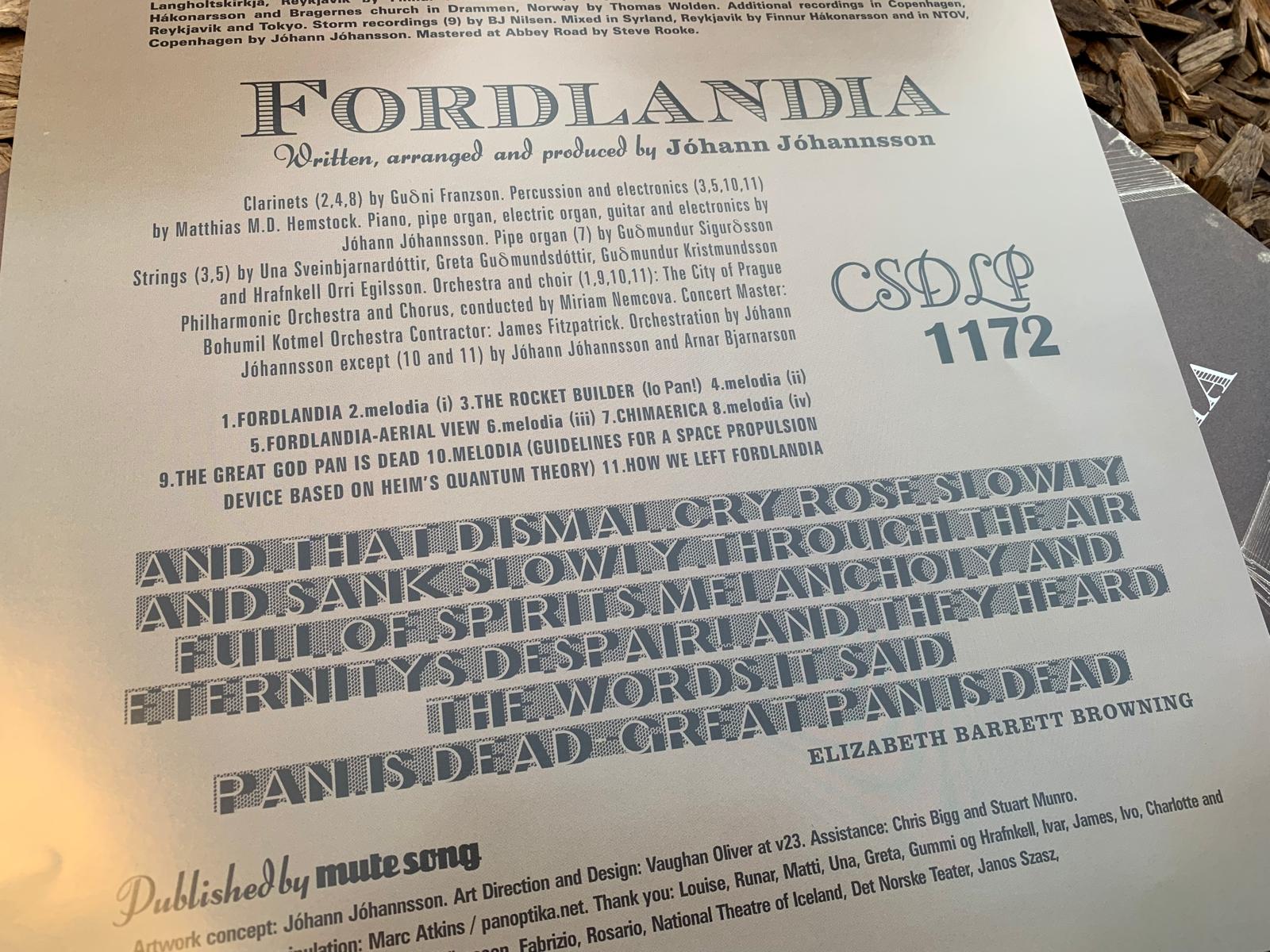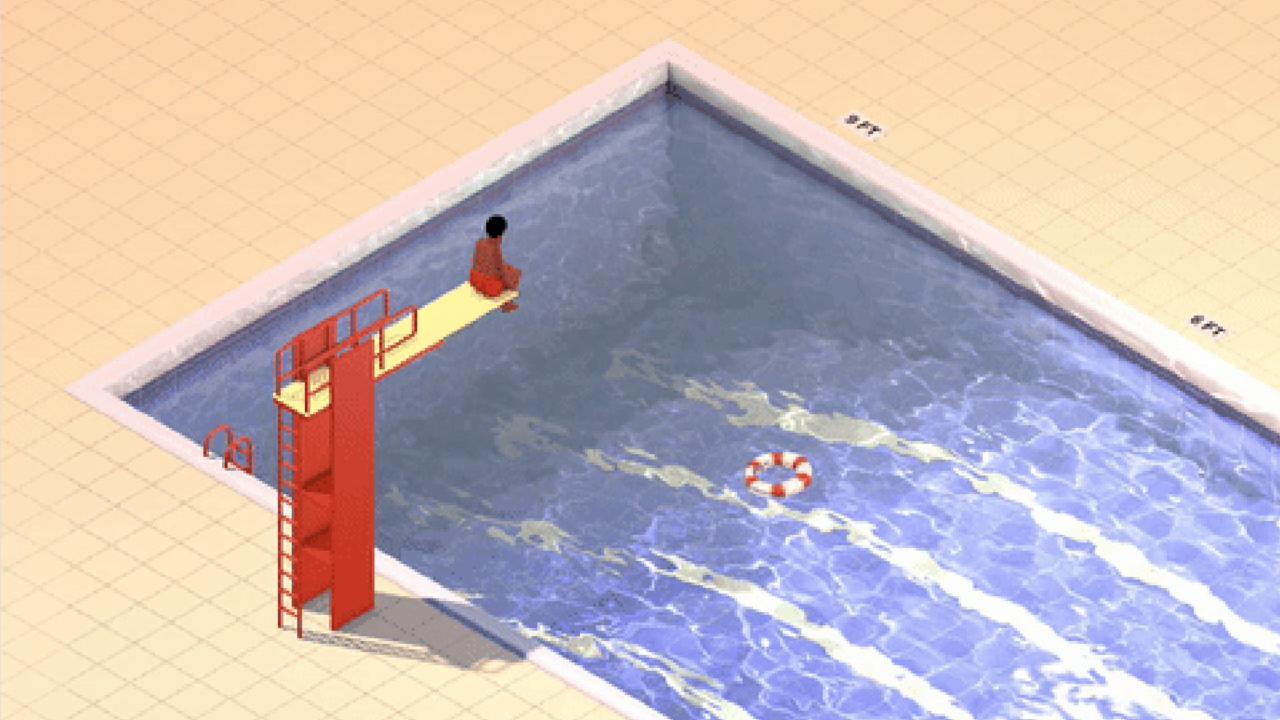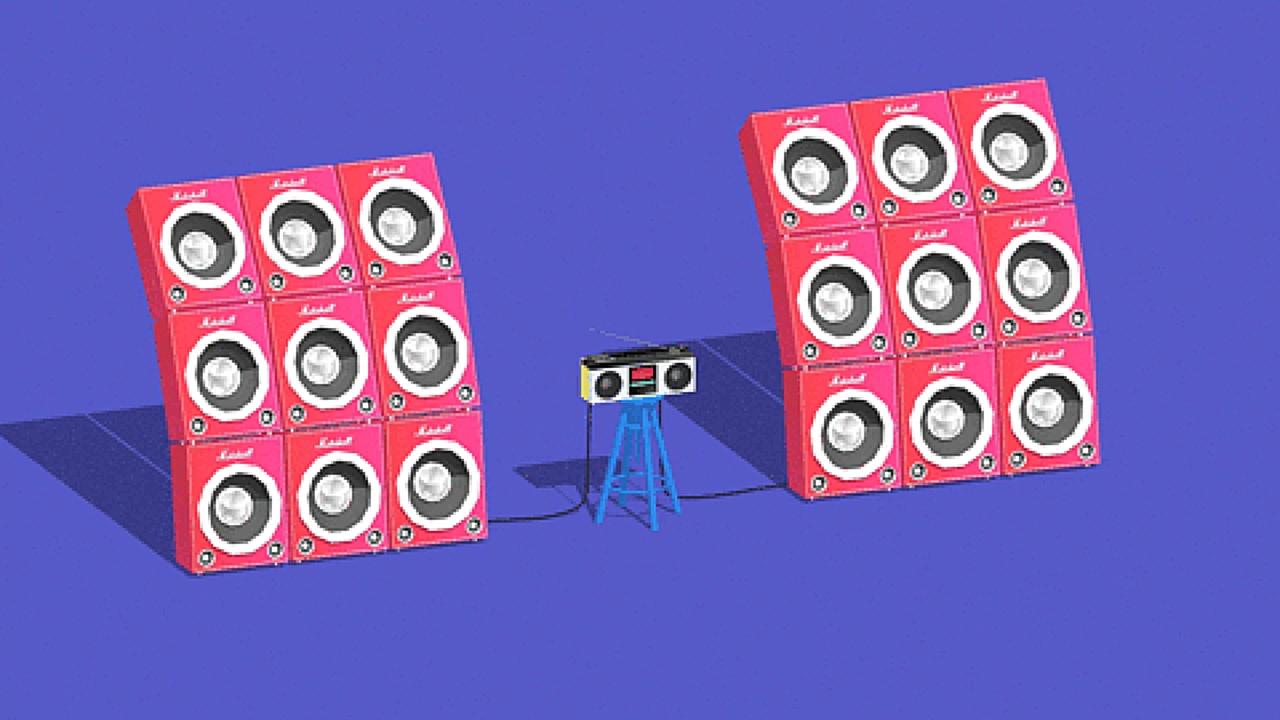Rewind: Klassiker, neu gehörtJóhann Jóhannsson – Fordlandia (2008)
11.10.2018 • Sounds – Gespräch: Thaddeus Herrmann, Martin Raabenstein, Fotos: Thaddeus Herrmann
Am 9. Februar 2018 starb Jóhann Jóhannsson. Zu diesem Zeitpunkt war aus dem isländischen Komponisten nach einer knapp 20-jährigen Karriere ein Weltstar geworden – überhäuft mit Auszeichnungen, vor allem für seine Soundtracks immer größerer Hollywood-Produktionen. Wer hätte 2002 schon damit gerechnet, dass aus dem Künstler, der damals auf dem wundervollen, aber doch auch sehr kleinen Londoner Touch-Label sein erstes Album „Englabörn“ veröffentlichte, mal der werden würde, der die Cinemaxx-Leinwände orchestriert? Seine Fans haben es ihm vielleicht gewünscht, insgeheim aber auch gehofft, dass es nie dazu kommen würde. Denn in Jóhannssons Musik lebte hinter der großen Geste auch immer die kleine ausgestreckte Hand, die man mit niemandem teilen wollte – schon gar nicht den Filmstudios. Jóhannssons Begabung, klassische Musik alles andere als klassisch klingen zu lassen, resultierte in den folgenden Jahren in gleich mehreren Alben, die heute – ja – Klassiker sind. Klassiker eines Genres oder einer Idee, die bis heute keinen Namen hat und auch nicht verdient hätte: Wer seiner Zeit voraus ist, muss sich nicht mit den Nachzüglern gemein machen. „Fordlandia“ ist eines dieser Alben. Martin Raabenstein und Thaddeus Herrmann hören mucksmäuschenstill zu.
Martin Raabenstein: Kann man „Odi et Amo“ von Jóhannssons 2002er-Album „Englabörn“ eigentlich noch toppen? Wenn auf dem ersten Soloalbum schon der erste Track die Latte so himmelhoch hängt, wie kommt man da in Folge immer wieder drüber?
Thaddeus Herrmann: Du warst später ja ganz optimistisch. Und ich überhöre diese Frage lieber – mir fehlt die passende Antwort. Ich schätze „Englabörn“ sehr, purzele aber ohnehin immer ganz tief in Jóhanns Platten hinein, wenn ich sie wieder von Neuem höre. So ging es mir auch hier. Der Opener und der Closer – die beiden Versionen des namensgebenden Themas – bilden eine derart starke Klammer, dass es mir fast schon egal ist, was dazwischen passiert. Und mich auch ausblenden lässt, dass Jóhannsson Henry Ford zum Sujet der Platte macht.
Martin: Lustig, dass du dich an diese Review erinnerst, lang, lang ist’s her. Ein paar Alben, also Jahre später, bin ich da dezent kritischer. Gerade die von dir erwähnten Tracks sind mein schmerzender Zahn.
Thaddeus: Hab ich es doch gewusst!
Martin: Dennoch verdient das Album 5 Sterne, gerade aufgrund der kleinen, für mich Jóhannsson ausmachenden „melodia“-Miniaturen. Da wird nicht übermütig der Cellobogen geschwungen, in der Kürze versteckt sich das Gewürz.
Thaddeus: Was groß beginnt, wir klein durchdefiniert. Finde ich auch wunderbar. À propos groß: Wo befinden wir uns hier, wenn man das Album auf der Zeitachse des Musikers sucht? Es ist seine zweite Platte für 4AD, zwei Jahre nach dem famosen „IBM 1401, A User's Manual“. Geschrieben hat er „Fordlandia“ für ein Tanztheater. Das muss sehr zeitlupig gewesen sein. Und wieder schwebt ein großes Thema über der Musik, auch wenn die Beziehung zur Musik hier besonders gut versteckt scheint. Das war bei der IBM-Platte noch anders, bot sich dort natürlich aber auch an. 2008 nimmt Jóhannsson den Bogen von „Englabörn“ wieder auf und findet seine Erfolgsformel. Man könnte ihm vorwerfen, sich hier schon technisch zu wiederholen, auch wenn das Resultat natürlich grundverschieden ist. Eine Visitenkarte für seine spätere Soundtrack-Arbeit, die ihn ja schließlich ins Grab gebracht hat. Ich komme darauf, weil – du beschreibst es ganz richtig – er schon viel mit Miniaturen arbeitet, die sich für Vertonungen natürlich bestens anbieten.

„Mir ist unklar, warum die Fachpresse später um Jóhanns Scores so ein Bohei gemacht hat.“
Martin: Ich habe nichts dagegen, wenn sich ein Komponist sicher in seiner Vorgehensweise ist, im Gegenteil. Solange er sich nur nicht in der Frahm'schen Endlosschleife verfängt. Mit „Fordlandia“ befindet sich Jóhannsson auf seinem künstlerischen Höhepunkt, es ist auch der Peak der sogenannten Modern-Classic-Bewegung, über diesen Begriff können wir uns gerne nochmal unterhalten. Mir ist unklar, warum die Fachpresse später um Jóhanns Scores so ein Bohei gemacht hat. Da stimmt für mich fast gar nichts mehr, außer einer schwer zu beschreibenden Resterinnerung seiner selbst, ein unscharfer, sich verflüchtigender Geist. Das beginnt bei „The Miners’ Hymns“ noch ganz okay, sinkt aber mit „Prisoners“ in dunkle Gewässer und verschwindet mit dem Soundtrack zu „Arrival“ völlig in der Tiefe.
Thaddeus: Die Arbeitsweise ist natürlich auch genau umgekehrt – ich weiß auch nicht so recht, wie man so etwas bewerkstelligen kann und ob das überhaupt für die Arbeit von Komponisten zielführend sein kann. Drehbuch lesen, Ideen aufnehmen, die ersten Bilder sehen, anpassen, alles wieder umschmeißen, Themen entwickeln, zusammenstauchen, variieren: Jóhannsson selbst mochte das, für ihn war die Arbeit an einem Soundtrack kaum anders als an einem „normalen“ Album: Auftrag ist Auftrag. Er schätzte es, wenn er in einem klar definierten thematischen Rahmen arbeiten konnte, dieses Gerüst gab ihm Sicherheit. Und doch ist das Ergebnis fundamental anders, da gebe ich dir recht. Was ja auch keine Überraschung ist. Denn es gibt natürlich Unterschiede zwischen einem Soundtrack und der Musik für Tanztheater.
Martin: Regisseure haben entweder große Angst vor zu starker Musik oder sie lieben Mickymousing. Das heißt, der Soundtrack bildet punktgenau das Gesehene ab. Also, mächtiges Gewese bei der Verfolgungsjagd mit aufgeregtem Getrömmel und Kuschelmuschel, wenn sich die Zungen aneinander verlieren. Das ist alberne, alte Banane. Theaterleute scheinen sich da weniger ängstlich zu zeigen, da hilft die mutige musikalische Geste dem Geschehen, begleitet und erweitert das Bild. Vielleicht hat Jóhannsson eben genau darum seine Arbeit für „Blade Runner 2049“ abgebrochen, der Zimmer schiebt da viel gefügiger den Taktstock in die gewünschte Richtung. Für einen feinsinnigen Menschen war der Umgang mit dieser eher ruppigen Branche sicherlich alles andere als einfach. Der Mann liegt noch nicht mal ein Jahr unter der Erde, ich finde es schwierig, da die richtigen Worte zu finden.
„Der Tod des Orpheus. Das ist das letzte Stück von Jóhannsson. Danach starb er. Ich bekomme schon wieder feuchte Augen – was für ein Schlusspunkt, der gar kein Schluss hätte sein dürfen.“
Thaddeus: Es geht uns ja auch nichts an. Uns bleibt die Trauer und vor allem die Frustration, dass solch ein begnadeter Musiker einfach keine Musik mehr schreiben kann. Mich beschäftigt aber noch etwas ganz anderes. Nach der Flut von Soundtracks hatte er ja 2016 mit dem Album Orphée wieder einen Weg gefunden, um seine Kreativität nicht auf die Bilder anderer malen zu müssen. Diese Platte schließt mit der „Orphic Hymn“: Textpassagen aus den Metamorphosen von Ovid, gesungen vom „Theater Of Voices“ unter der Leitung von Paul Hillier. Der Tod des Orpheus. Das ist das letzte Stück von Jóhannsson. Danach starb er. Ich bekomme schon wieder feuchte Augen – was für ein Schlusspunkt, der gar kein Schluss hätte sein dürfen. Aber gut. Es gibt Dinge, die man sich nicht aussuchen kann. Außerdem schweife ich fürchterlich ab. Ich komme nochmal auf „Fordlandia“ und die Klammer, die ich eingangs erwähnte ...
Martin: Jetzt hör schon auf zu dirigieren, schreib weiter ...
Thaddeus: Ich kann nicht anders. Wenn ich mich für den einen Jóhannsson-Track entscheiden müsste, dann wäre es der Closer dieses Albums: „How We Left Fordlandia“. Ein derart zugespitztes Arrangement mit all seinen kaum wahrnehmbaren Nuancen und Stimmungswechseln – das hätte den Oscar verdient. Das wogt selbst dem größten Profi-Surfer zu hoch, ist eine unfassbar emotionale Welle, an die sich niemand herantraut. Soviel Stärke braucht Distanz. Natürlich auch, weil man in der Geschichte der Platte drinsteckt. Dem missglückten Hirngespinst von Henry Ford, diesem Arschloch, der sich in Brasilien eine Kautschuk-Plantage gebaut hat, um den Rohstoff für die Autoreifen selber herzustellen und nicht länger in England teuer zukaufen zu müssen. So entstand „Fordlandia“, eine Arbeitersiedlung oder -kleinstadt. Eine von der Besessenheit des Kapitalismus geformte Gutmenschen-Geste, in der sich die Arbeiterinnen und Arbeiter jedoch überhaupt nicht wohl fühlten. Ging schief. Und so schlimm man Ford auch finden kann, dieses Stück beschreibt das Ende. Den Abzug – der letzte macht das Licht aus. Schon wieder große Emotionen, die etwas Endgültiges symbolisieren. Das Artwork des Albums gibt sich reduziert, grafisch und auch ein bisschen technisch – das ist dann wieder an Anknüpfungspunkt an „IBM 1401, A User's Manual“. Wird auch auch konterkariert von grobkörnigen Fotos mit reichlich Patina. Da läuft es heiß und kalt den Rücken runter.


Martin: Musikalisch ist das schlicht und ergreifend klassisches Minimalisten-Handwerk. Hör dir „Music for 18 musicians“ von Steve Reich, oder den Glass’schen Soundtrack zu „Koyaanisqatsi“ nochmal an. Vor allem den letzte Track, davon schwirrt hier auf diesem Album schon ganz schön was rum. Ich bin kein Fan von Jóhannssons breit angelegten Streicherarrangements, kann aber dennoch ganz gut nachspüren, was dich da so bewegt.
„Der Jóhann, der hat in seiner Musik so eine geheime Zutat, den Jóhannsson-Kniff, der selbst den größten Kitsch noch dreht.“
Thaddeus: Den Dreh zu „Koyaanisqatsi“ hatte ich bis heute nie gesehen bzw. gehört. Ich danke für den Hinweis – da gibt es klare Überschneidungen, bzw.: Herr Jóhannsson hat bei Herrn Glass ausgesprochen gut zugehört. Vielleicht kann man da ja einen Megamix draus mixen. Und: Ich bin mir bis heute selber nicht, warum mich Jóhannssons Streicher immer wieder so bewegen. Würde mir die ein anderer vorsetzen – ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Der Jóhann, der hat in seiner Musik so eine geheime Zutat, den Jóhannsson-Kniff, der selbst den größten Kitsch noch dreht.
Martin: Kitsch, dieses Wort wollte ich nicht verwenden, aber ich bin da völlig bei dir. Jóhannsson hat die wunderbare Fähigkeit, genau die Grenze zwischen triefender und berührender Emotionalität aufzuspüren, obwohl er da manchmal schon ganz ordentlich in schlimm romantischen Klischees taucht. Aber sprechen wir doch nochmal die Zeit an, zu der „Fordlandia“ entstand, 2008. Ich glaube, wir hatten gerade angefangen, gemeinsam an der „Reflections on classical music“ zu arbeiten. Eigenartigerweise kann ich mich nicht mehr erinnern, warum „Odi et Amo“ bei der Schlussauswahl zu dieser Compilation nicht mehr dabei war. Grund für die Zusammenstellung war ja dieser neue Style, einen Namen hatten wir damals auch noch nicht. Klassisch ausgebildete Musiker kombinieren elektronische Elemente mit kammermusikalischen Versatzstücken, das war faszinierend frisch und begeisternd anders.

Thaddeus: Und funktionierte in beide Richtungen – das war für mich das Entscheidende. Einer dieser seltenen Momente, in der sich zwei Haltungen bzw. Traditionen trafen und so für eine kurze Zeit etwas wirklich Neues entstand. Was da genau schief lief in der Folge, erinnere ich nicht mehr. Wahrscheinlich war es einfach die schiere Masse an Veröffentlichungen, die das eigentlich ja hehre Unterfangen dann im allgemeinen Noise untergehen ließ. Kein Wunder, wenn das signal ohnehin schon eher leise ist.
Martin: Und ja auch genau so verbleiben wollte.
Thaddeus: Das! Und: Copycats haben noch jede Idee kaputt bekommen. Aber selbst viele der Originators haben sich ja im Laufe der Zeit gedreht und geben heute eher Anlass zum Schimpfen. Sich weiterzuentwickeln gehört dazu – kein Vorwurf in diese Richtung. Aber was genau ist da passiert?
Martin: Dieses Genre hatte eine Halbwertszeit wie alle anderen auch. Sagt man nicht, fünf Jahre hält die Ware? 2011 war dann Schluss. Dieses kleinteilig feine Geknispel wich dem 4/4-Gebot, das ist das Gegenteil von leise. Und bei aller Liebe für die Gründungsidee, das Romantiktöpfchen ist eben nunmal nicht so riesig, um ein Jahrhundert voller Meisterwerke daraus zu zaubern.
Thaddeus: Und alle haben dennoch schamlos reingekackt. Das waren schlimme Jahre – wieder in beide Richtungen. Arnalds bildet sich ein, als Kiasmos Dancefloor machen zu müssen, und Carl Craig spielt Techno mit Orchester. Au weia. Interessant ist ja, dass Jóhannsson seine Bassdrum-Phase zum Zeitpunkt von „Fordlandia“ schon hinter sich hatte. Einmal freigestrampelt, kurz getanzt und sich dann auf das Wesentliche konzentriert. Vorbildlich.