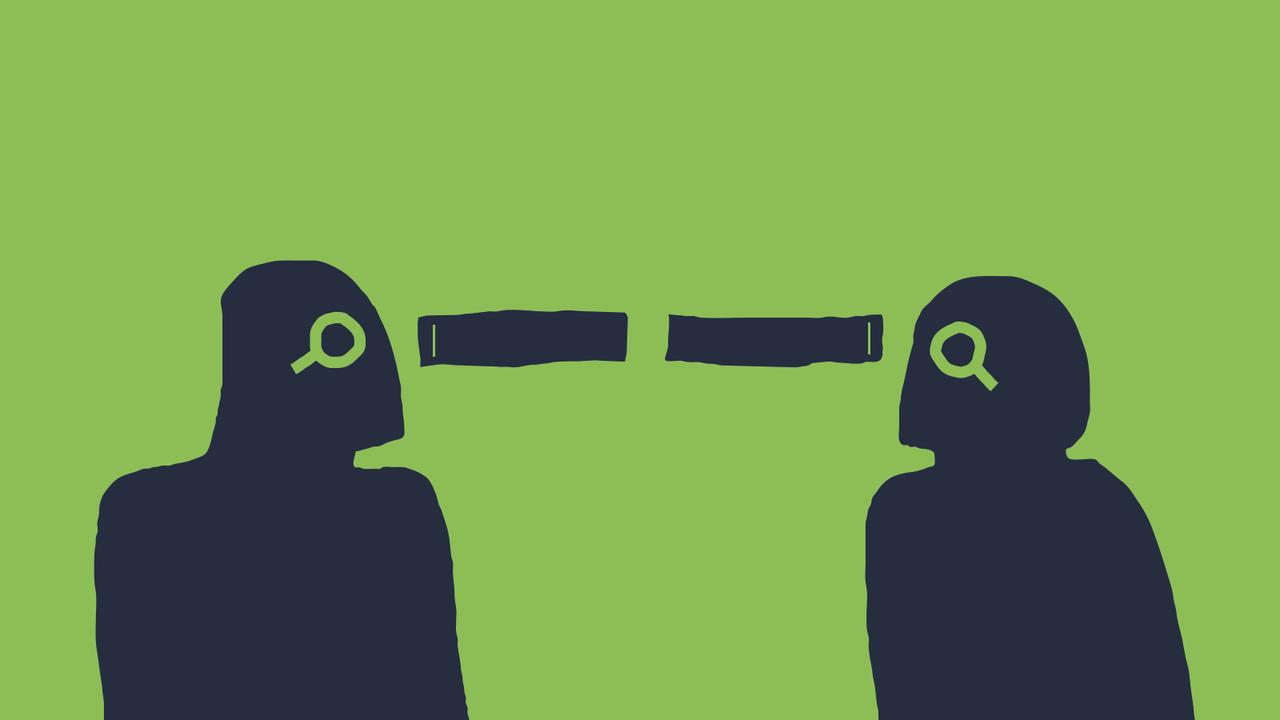Immer nur DerridaInterview: Stefan Schneider und Jay Ahern sind die Hauntologists
14.7.2015 • Sounds – Interview: Thaddeus Herrmann
Stefan Schneider (links) und Jay Ahern. Bild: Lucy Dax
Zwei musikalische Charaktere, die erst auf den zweiten Blick zusammenpassen. Stefan Schneider war Bassist bei To Rococo Rot, spielte bei Kreidler, hat mit Bill Wells gearbeitet, aber auch mit Hans-Joachim Roedelius. Jay Ahern hingegen hat mit seinen Projekten Add Noise, Cheap And Deep und Aquarhythms den Dancefloor entscheidend geprägt, nicht nur auf seinem eigenen Label Earsugar. Als Hauntologists verschreiben sich die beiden seit mittlerweile acht Jahren dem reduzierten Dub-Dancefloor im Viervierteltakt. Zwei Männer und ihre Maschinen oder: erst die Aufnahme, dann der Mix. Nun ist ihr Debütalbum erschienen.
Wie entscheiden sich eigentlich zwei so unterschiedliche Musiker dazu, gemeinsam Musik zu machen?
Jay Ahern: Ich bin mit gar nicht sicher, ob das so stimmt. Als ich noch in Irland lebte, hörte ich eine Mapstation-Platte, also eine von Stefans Solo-Produktionen. Fan von To Rococo Rot war ich ohnehin, nur Stefans Band andere Band, Kreidler, kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Stefan Schneider: Ging mir eigentlich genauso. Ich verfolgte, was Jay auf seinem Label Earsugar machte und mochte besonders die Add-Noise-Platten. Als dann klar war, dass die von ihm waren, haben wir ein bisschen gemailt und uns schließlich getroffen.
Also Fantum. Und dann?
Stefan: Wir haben beide eine Vorliebe für Hardware, wobei das bei unserem gemeinsamen Projekt nicht die ausschlaggebende Gemeinsamkeit ist. Ich fand es von Anfang an faszinierend, wie schnell Jay Rhythmen programmieren kann.
Jay: Mich hat die Art und Weise, wie Stefan arbeitet, schon immer berührt. Er baut keine Stücke, sondern arbeitet an komplexen Systemen, an lebendigen Organismen. Das ist einzigartig. Und da schwingt auch immer ein bisschen Acid mit, was aber gar nicht entscheidend ist. Viel wichtiger finde ich die fluide Struktur, was für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt der Dance Music war. Oder generell bei Musik, die man in der einen oder anderen Art und Weise auflegen, ineinandermischen kann.
Stefan: Wir arbeiten schon von Beginn an nach einem bestimmten Schema zusammen. In Jays Studio nehmen wir auf, ich nehme die Files dann mit zu mir ins Studio und ich mache den Mix. Eine fast schon klassische Rollenverteilung also, die man ja im Idealfall generell bei Bands vorfindet. Bei Ro Rococo Rot und Kreidler haben wir ganz ähnlich gearbeitet.
So funktionieren Bands einfach, oder?
Jay: Das ist ein extrem wichtiger Aspekt in unserer Arbeit. Meiner Meinung nach geht es bei den Hauntologists nicht nur um zwei Musiker, die – wie viele andere auch – Hardware für sich wieder entdeckt haben und nicht am Computer arbeiten. Es geht um den Prozess. Wir sind beide große Dub-Fans und ich sehe da viele Parallelen. Erst die Aufnahme, dann der Mix. In „Tubby Düsseldorf“.
Stefan: Und manchmal funktioniert das, manchmal aber auch nicht. Wir stehen im Vordergrund, wir treffen Entscheidungen. Es geht nicht darum, die Maschinen stundenlang laufen zu lassen und sich im Anschluss die besten Momente heraus zu schneiden, um so die Tracks zu editieren. Die Arbeitsschritte sind klar definiert.

Wenn die Rollen so klar definiert sind: Wie wichtig ist es dann überhaupt noch, sich im Studio zu treffen?
Stefan: Es funktioniert nur, wenn wir gemeinsam Zeit verbringen. Das hat sich sehr schnell herausgestellt. Ich habe beispielsweise einen Hauntologists-Remix für Hauschka allein gemacht. Das war einfach nicht das Gleiche. Ich arbeite ja regelmäßig mit anderen Musikern an Projekten, habe es aber mittlerweile zur Bedingung gemacht, dass wir tatsächlich gemeinsam arbeiten, uns also treffen. Files hin- und herschicken, darauf lasse ich mich nicht mehr ein.
Ich finde es nach wie vor überraschend, dass du dich überhaupt auf so ein Dancefloor-Projekt eingelassen hast, Stefan.
Stefan: Dabei hat das in meiner Arbeit immer eine Rolle gespielt. Auch bei To Rococo Rot. In der Presse ging es dann aber immer nur um Postrock und Krautrock. Keiner interessierte sich für die graden Bassdrums auf unseren Platten. Dann mit Jay Musik zu machen und die erste EP auch noch praktisch anonym zu veröffentlichen: Das war schon eine Befreiung.
Mir wäre es nur recht gewesen, wenn sich nicht aufgeklärt hätte, wer die Hauntologists sind. Die Omar-S-Vermutung fand ich ganz wunderbar.

Anonymität ist ja ein verklärter Techno-Traum.
Jay: Es hat ja auch nicht lange gehalten. Wäre vielleicht auch nicht angemessen. Wir machen das Projekt mittlerweile seit acht Jahren. Mit Pausen, aber immerhin. Eine lange Zeit, in der viel passiert ist, nicht nur bei unserem Projekt auf musikalischer Ebene, sondern auch bei der generellen Wahrnehmung der elektronischen Musik. Als das Album angekündigt wurde, stolperte ich über einen Tweet von einem Redakteur des Factmag. Der ging ungefähr so: „Natürlich heißen sie Hauntologists, natürlich kommen sie aus Berlin und natürlich machen sie Minimal Techno.“ Ich habe darauf wirklich geantwortet, weil mir das schon nahe ging. Ein anderer Journalist schrieb: „Die Geister der Vergangenheit heraufbeschwören mit Hilfe einer toten Musikrichtung.“ Hoppla.
Nun war Hauntology aber auch ein besonders fieses Zucken der Hype-Maschine. Eigentlich ja der Beginn einer Phase, in der man alles veröffentlichen konnte und es einfach als Kunst deklarierte.
Jay: Ein Hype, der komplett an mir vorbei gegangen ist. Für mich war es immer nur Derrida, der den Begriff ja in seiner Auseinandersetzung mit Europa und dem Kommunismus geprägt hat. Ich lebte damals in Irland und assoziierte das alles mit Ost-Berlin.
Nicht nur der Name Hauntologists verursacht Reibung, auch die Afrika-Referenzen in den Liner-Notes. Ein sehr beliebtes Klischee und ein oft missverstandener Anknüpfungspunkt in der elektronischen Musik, weil es meist einfach in unreflektiertem Ethno-Sampling endet.
Stefan: Die Afrika-Referenz kommt vielleicht ein bisschen zu forsch daher.
Jay: Aber du hast eine sehr enge Beziehung zu afrikanischer Musik, Stefan, warst auch schon oft dort und hast Aufnahmen gemacht.
Stefan: Und das war wirklich eine Offenbarung. Afrikanische Musik ist für mich eine Art Grammatik, die sich – bewusst oder unbewusst – in der Welt verbreitet hat. Die Einflüsse sind also da. Wie das dann umgesetzt wird, ist eine ganz andere Frage. Oder wie es kommuniziert wird. Bei meiner Band Kreidler hieß es von Anfang an: Das ist Krautrock. Komplettes Missverständnis. Wir haben uns immer als Popband gesehen. Solche Dinge lassen sich oft auch nicht mehr richtigstellen.
Jay: Ich habe einen ganz anderen Bezug zu Afrika. Ich bin in den USA aufgewachsen, also ist es für mich afro-american. Die Wurzeln sind ja die gleichen, lediglich die Ausprägungen klingen vollkommen anders. HipHop, Bass Music aus Florida mit den kubanischen Einflüssen – das spielt alles zusammen. Das ist amerikanische Musik, würde aber ohne diese Einflüsse nicht existieren.
Stefan: Rhythmus ist letztlich ja wirklich eine universelle Sprache. Ich habe das gemerkt, als ich vor ein paar Jahren in Algier gespielt habe. Dort lief damals kaum elektronische Musik. Nach dem Konzert hörte ich aber von ganz vielen Besuchern, dass sie sich sofort heimisch gefühlt hätten in meinen Tracks und es sie an algerische „Trance Musik“ erinnert hätte. Mit welchen Instrumenten das gemacht wird, war denen vollkommen egal. Die Struktur war entscheidend.
Jay: Musik bekommt man entweder in die Wiege gelegt oder man lernt das Gefühl dafür zu entwickeln, weil man nahe dran ist. Da schließt sich der Kreis für mich und Stefan. Wir müssen uns im Studio gemeinschaftlich darauf einlassen, vom anderen lernen und den anderen inspirieren. Sonst würde das nicht funktionieren.
Hauntologists, Hauntologists, ist auf Hauntologists erschienen. Album bei iTunes