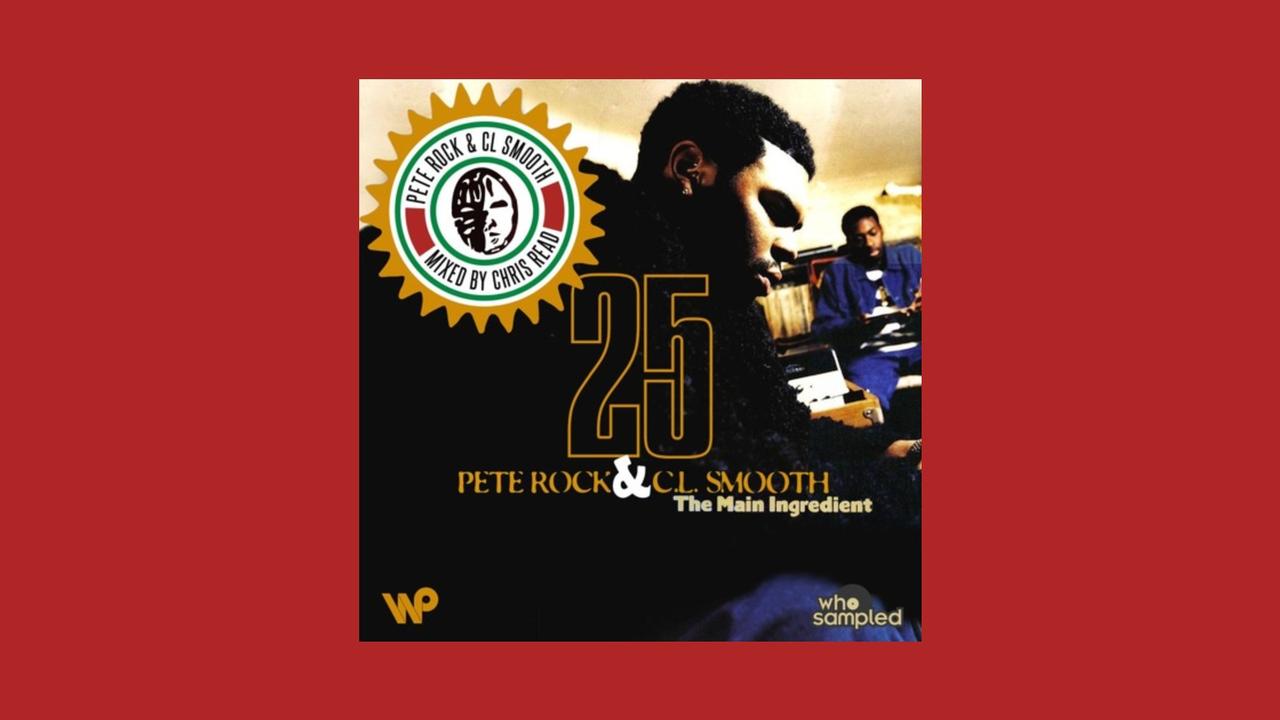Jede Woche liest die Redaktion das Internet leer, um sonntäglich vier Lesestücke empfehlen zu können. Artikel, die interessant, relevant oder gar beides sind – und zum Glück abgespeichert wurden.
E-College-Sports
In den USA hat man als guter Sportler – man kennt die Klischees aus unzähligen amerikanischen Filmen – gute Chancen, ein Stipendium für die Uni zu bekommen. Ob Basketball oder Football. Wer ganz nach oben will, ist in der Regel im Schulsport schon ein Ass. Die Sportstipendiaten müssen sich in der Regel weniger um die intellektuelle Bildung kümmern. Es ist ein komisches System. Nun hat der Hochschulsport in den USA aber E-Sports für sich entdeckt. Nun könnten, wenn man den Protagonisten Glauben schenken mag, Nerds die neuen Campus-Lieblinge werden und den Sunny-Boy-Quarterbacks den Rang ablaufen. Denn natürlich geht es auch im E-Sports mittlerweile um eine Menge Geld. Eigene College-Ligen sind bereits etabliert. Wie Fortnite und Overwatch Einzug in das US-Unisystem halten, lest ihr in diesem Feature von Ethan Gilsdorf.
Some colleges, many of them tech schools, have invested heavily in competing at the highest level. Harrisburg University of Science and Technology, whose Overwatch team, the HU Storm, was the 2019 ESPN Collegiate Overwatch Champion, has 26 esports students on scholarship and housing stipends. They work out in a $1.3 million esports training facility. HU’s annual esports budget for teams is $2 million, which pays for coaches, staff, facilities, technology, travel, and events.
Das (literarische) Ich
Schriftstellerin Zadie Smith hat lange mit der Ich-Erzählung gehadert, ist sie sich doch der Tatsache bewusst, dass dem Leser die Trennung von Autor und Erzähler gemeinhin nicht glückt – sie kenne es ja von sich selbst. Anstatt sich damit zu begnügen analysiert Smith die Beziehung zwischen Autor und Ich-Erzähler im Rahmen der „Philip Roth Lecture“ in der New York Public Library. Es geht um das Zusammenwirken von Fiktion und Autobiographie beim Schreiben, um Identitäten und Ersatz-Ichs und deren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Spannendes Literatur-Meta-Stück.
Doch anstatt meine Geringschätzung für diesen autobiografischen Instinkt beim Lesepublikum und bei mir selbst zu äußern, möchte ich lieber nach einer Möglichkeit suchen, das „Ich, das ich nicht bin“ der Schreibenden mit dem „Ich, für das ich dich halte“ zu versöhnen, das die Leserschaft zu sehen glaubt. Schreibende behaupten ja grundsätzlich, es sei alles fiktiv, und Lesende haben grundsätzlich den Verdacht, dass das nicht stimmt. Wer hat recht?
Langsame Langstrecke
Wer oft und vor allem weit reist, ist an die vorwurfsvollen Blicke und unausweichlichen Nachfragen bereits bestens gewöhnt, zumindest wenn der gesamte Freundeskreis die vergangenen Jahre nicht unter einem Stein verbracht hat. Will Vibert hatte genau darauf keine Lust mehr. Und fuhr mit dem Containerschiff von Hamburg aus in seine kanadische Heimat und nahm zum ersten Mal nicht das Flugzeug. Neben der für so eine Passage dringend benötigten Zeit, trieben ihn aber auch ganz andere „Sorgen“ um: Was zur Hölle macht man auf einem Containerschiff den lieben langen Tag? Für den Guardian hat er die Geschichte aufgeschrieben. Fazit: wenig CO2, viele tolle Erfahrungen und dringend zur Nachahmung empfohlen.
A daily routine quickly emerged: morning coffee on the bridge with the gregarious chief officer, sociable mealtimes with the crew, and hourly strolls around the outer decks, the frigid ocean wind buffeting my face and dark waters churning below.
I didn't want to fly – so I took a cargo ship from Germany to Canada
Berliner Essen: oft (noch) schlecht
Trotz nicht endendem Foodhype sieht der Berliner Ess-Alltag noch so wolkengrau aus wie ein Januardonnerstag, es regiert das Mittelmaß, konstatiert der Blog „Stil in Berlin“. So ein Urteil fällt sich leicht, weniger leicht fällt es, es auch zu belegen und zu begründen. Dieser Beitrag sucht und findet viele Gründe, warum die Esskultur der Hauptstadt anno 2020 so ist, wie sie ist – es hat was mit erst relativ kurz verschwundenen Mauern und Zäunen zu tun, mit lange Zeit planwirtschaftlicher Lebensmittelproduktion im Umland, mit mageren Gehältern, mit preußischem Genussverzicht und mit deutschen Eigenheiten (z.B. schleppender Integration und blühender Bürokratie). Ein Text wie eine Zwiebel mit vielen Schalen, ein bisschen zum Heulen, aber es gibt Hoffnung und es wird besser, sagt Stil in Berlin.
Wir schätzen weder das Extravagante, noch rennen wir den neuesten Innovationen hinterher. Mehr noch, wir vermeiden Trends, wo es geht – diese faden und definitiv vorübergehenden Launen, die nur dafür gemacht sind, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wir sind regelrecht besorgt, dass andere uns als oberflächlich abstempeln, wenn sie sehen, wie wir jeden neuen Trend mitmachen.