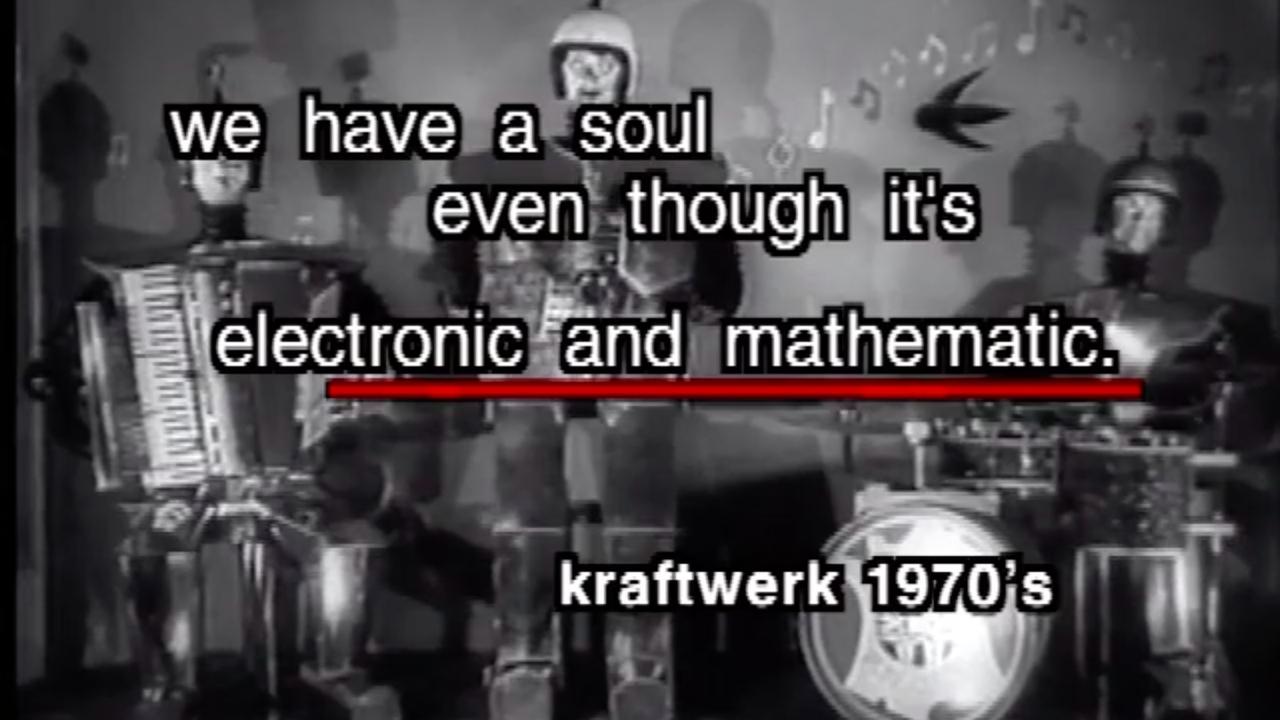Foto: 20th Century Fox
Der Rückblick auf die Blockbuster der Saison, Teil 2: Diesmal geht es um Sci-Fi-Dystopien und alternde Hollywoodstars.
Auch Bryan Singer ist wie Gareth Edwards - siehe Teil 1 unseres Reviews - ein Angeber-Regisseur, wenngleich auf höherem Niveau. Für „X-Men: Days of Future Past“ ist der Macher der ersten beiden „X-Men“-Filme wieder auf den Regiestuhl zurückgekehrt und versucht sich an einer Art Synthese der bisherigen Filme – die beiden „Wolverine“-Filme mit eingerechnet. Über einen Zeitreise-Plot vereint er den Ur-Cast der alten Filme mit den Stars (Michael Fassbender und James McAvoy) des letzten Prequels „X-Men: First Class“. Die dort begonnene Verortung im Historischen (Magneto als traumatisierter Nazi-Jäger) setzt sich nun als eine umfassende Revision der amerikanischen Geschichte der 70er Jahre fort, in der die X-Men nun sowohl in das Attentat auf Nixon als auch in das Ende des Vietnam-Krieges verwickelt sind.
Gefräßig verleibt sich der Film analoge Fernsehbilder und Paranoiadiskurse der 70er ein, ohne aber dem kosmischen Verschwörungswahn irgendeine politische Pointe abringen zu können.
X-Men rule the world, past, present and future. Bleiben ein paar schöne Momente: James McAvoy, der in Reminiszenz an Timur Bekmambetovs „Wanted“ in Bullet-Time Kugeln um die Ecke schießt; Michael Fassbender im teutonischen Stahlhelm, der ein ganzes Baseballstadion durch die Lüfte dirigiert. Das nächste Sequel/Prequel steht schon in den Startlöchern. Es heißt – wie könnte es anders sein: „X-Men: Apocalypse“.
Transcendence
Auch die beiden interessantesten Blockbuster der letzten drei Monate sind prä- und postapokalytisch temperiert, bewahren sich aber im Gegensatz zu Bay und Konsorten ein Minimum an ästhetischem Geschichtsbewusstein: „Transcendence“ und „Edge of Tomorrow“ sind beides vordergründig Sci-Fi-Dystopien, fransen aber generisch in ganz andere Richtungen aus.

Foto: Warner Brothers

Foto: Warner Brothers
„Transcendence“, der Debutfilm von Christopher Nolans Kameramann Wally Pfister, von kleingeistigen Kritikern zu Unrecht geschmäht, ist trotz aller Schwächen schon dadurch ein gewagtes Experiment, als dass er sich an einem Starkino ohne Star versucht.
Der zuletzt karrieregeknickte Johnny Depp wird nämlich als zerstreuter Wissenschaftler nach weniger als einem Filmdrittel ins Jenseits befördert, um dann von seiner Freundin (Rebecca Hall) als digitaler Netzwerk-Geist wieder hochgeladen zu werden. So blickt uns Johnny Depp den Rest des Films als reanimiertes körperloses Superhirn aus riesigen Bildschirmen entgegen, welches mit der Hilfe Rebecca Halls ein gigantisches nanotechnologisches Labor in der Wüste aufbaut. Doch die emotionale Intelligenz dieses digitalen „Mad Scientists“ kann mit seiner künstlichen Intelligenz nicht mithalten, so dass die Nano-Partikel zwar alle Krankheiten heilen, die Kurierten aber leider auch zu unsterblichen Zombies verwandeln. Die technophile Technophobie des Films findet seinen ultimativen Ausdruck in dem widernatürlich mutierten Nano-Regen, der gegen die Schwerkraft in den Himmel schwebt. (Überhaupt scheint die Anti-Gravity einer abhebenden Materie zu einem Money-Shot des gegenwärtigen Blockbusters geworden zu sein: So lassen sowohl der Magnetismus des Alien-Motherships in „Transformers 4“ als auch Magneto in „X-Men“ ganze Städte vom Boden abheben).
Das ist wohl die Transzendenz eines digitalen Kinos, das sich vor seiner eigenen Wunder-Technologie fürchtet. In analoger (Genre-) Nostalgie ruft Wally Pfister nun neben deutlichen Western-Zeichen auch das ganze Tränen-Register des klassischen Melodramas auf, indem nur der Liebestod des Paares die Welt vor der totalen Kontamination durch den Nano-Virus retten kann. Aber da Johnny Depp leider auch nicht mehr als ein anthropomorpher Computervirus ist, dreht sich die schale Melancholie des Films um eine Leerstelle, die auch der digitale untote Superstarkörper nicht länger füllen kann.
Edge of Tomorrow
Auch Doug Limans cleverer „Edge of Tomorrow“ kann als Kommentar zur Krise des Starsystems verstanden werden: Hier gerät der ewig jugendliche Tom Cruise im postapokalyptischen Kampf gegen eine Alien-Invasion in eine „Groundhog Day“-artige Zeitschleife, in der auf das Sterben das prompte Erwachen im Loop erfolgt. Infiziert vom Blut eines „Mimic“-Alien, das sich durch Zeitachsenmanipulation unsterblich machen kann, muss Cruise nun die Wiederholung durcharbeiten, um das Mother-Alien zu vernichten. So durchgeknallt wie das klingt, ist tatsächlich auch der Film. Während „Transcendence“ Sci-Fi, Western und Melo zusammenmischt, ist „Edge of Tomorrow“ ein stranges Amalgam aus Sci-Fi, Screwball Comedy und Kriegsfilm. Denn nicht nur muss Cruise wie in einer auf Repeat geschalteten „Remarriage Comedy“ Tag für Tag die toughe Emily Blunt von Null an umgarnen (wie einst Adam Sandler die amnestische Drew Barrymore in dem bezaubernden „50 First Dates“), sondern gleichzeitig mit reichlich anachronistischer Waffenmechanik den ersten Weltkrieg mitsamt der Schlacht von Verdun reinszenieren.
Ein immaterialisierter Johnny Depp, ein geloopter Tom Cruise – das ist der Status Quo eines alternden Starsystems, das vielleicht bald von der vollends posthumanen Visage eines Transformer-Roboters in die „Extinction“ befördert wird.
So beamt sich auch „Edge of Tomorrow“ wie „Transcendence“ (film)historisch in die Vergangenheit zurück, entkommt aber auch nicht den Aporien der digitalen Unsterblichkeitsfantasie: Wenn am Ende des Films Tom Cruise sein berühmtes Grinsen aufsetzt, ist auch er längst zu seinem eigenen Klon geworden. Ein immaterialisierter Johnny Depp, ein geloopter Tom Cruise – das ist der Status Quo eines alternden Starsystems, das vielleicht bald von der vollends posthumanen Visage eines Transformer-Roboters in die „Extinction“ befördert wird. Ohne jetzt zu sentimental humanistisch zu klingen – da weine ich doch dem verschwindenden Menschen eine kleine Träne hinterher.