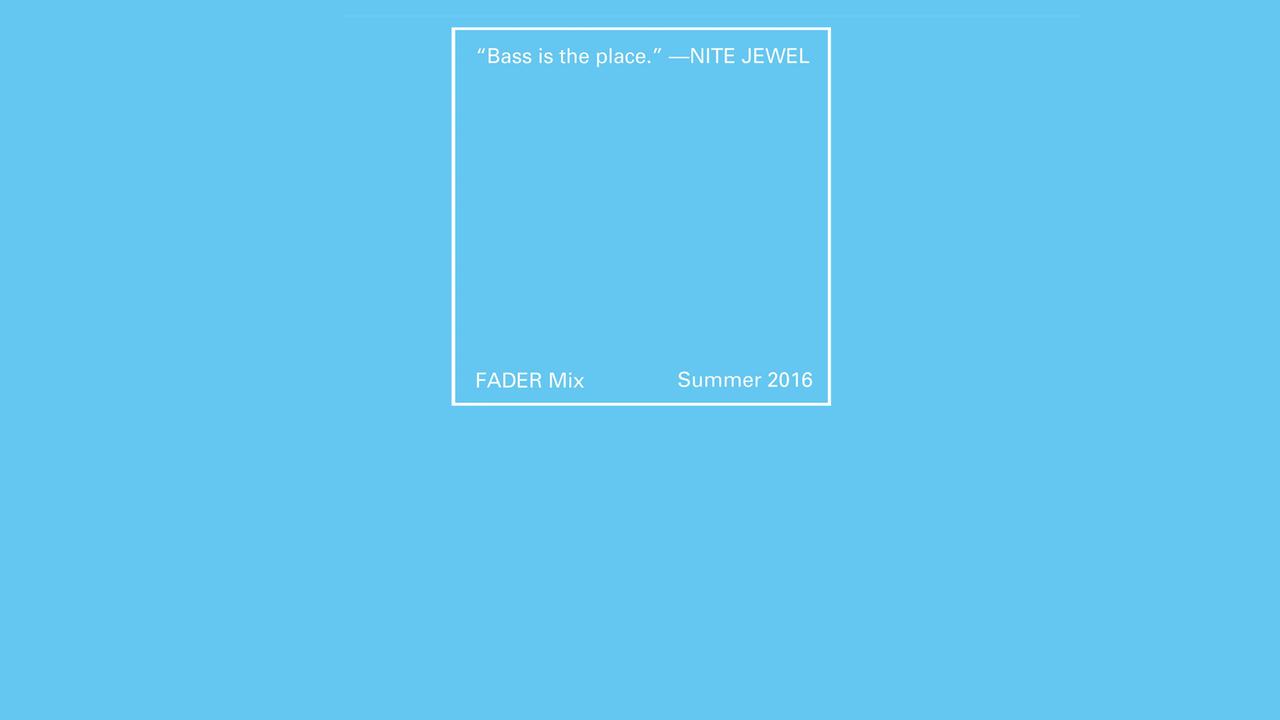„Ich schreibe keine catchy Songs“Interview: Matthew Dear aka Audion über Techno-Jams und das neue Detroit
8.7.2016 • Sounds – Interview: Benedikt Bentler
Fotos: Chris Arace
Matthew Dear ist zurück. Nicht als Matthew Dear, also mit Akustik, Vocals und einer Band für die Bühne, sondern als Audion. Und das bedeutet: Maschinenmusik, Modularsysteme und konsequent 4/4. Sein neues Album „Alpha“ führt einen geradezu auf düstere Tanzflächen, kommt aber gänzlich ohne die Happy- und Catchyness eines Tracks wie „Mouth to Mouth“ aus, für den Dear erst kürzlich neue Remixe in Auftrag gegeben hatte. „Alpha“ klingt kalkuliert und verspielt zugleich. Verspielt in Acid-Sounds, die durch Umstecken von Kabeln an Patchbay und Modular-Synthies immer wieder kleine, unerwartete Wendungen nehmen. Kalkuliert, weil jeder Track seinen Weg von der ersten bis zur letzten Kick konsequent zu Ende geht. Ein metallischer Grundton durchzieht die dreizehn Tracks des Albums. Als wären die einstigen Detroiter Industriestätten zu neuem Leben erwacht. Tatsächlich ist Matthew Dear auch genau dorthin zurückgekehrt, in die Nähe der Motor City. Redakteur Benedikt Bentler hat mit ihm gesprochen: Über die Rückkehr in ein tatsächlich verändertes Detroit, aber auch über die Rückkehr zu Techno, Sieben-Stunden-Sets und die Bedeutung von Visuals.
Wie kommt's, dass du jetzt wieder Audion bist? Nach deinen letzten Veröffentlichungen hatte ich das Gefühl, du würdest total in deiner Band aufgehen.
Ich versuche eigentlich, mich immer um alle Projekte parallel zu kümmern. Dieses Mal hat es jedoch länger gedauert, mich vom Gesang und der Band zu lösen und auf Audion zu konzentrieren. Tracks habe ich aber die ganze Zeit über gemacht. Jetzt musste das Album einfach raus. Audion ist mein Ausgleich zur Band.
Also geht es auch mit der Band weiter?
Klar. Mit der Band geht es vor allem darum, die Musik, die ich zu Hause im Studio mache, auf die Bühne zu bringen. Denn im Studio bin ich ja komplett allein und schreibe alles selbst. Ich mache die ganze Zeit nebenbei Aufnahmen mit Vocals und probiere Dinge aus. Zehn Songs für das nächste Album als Matthew Dear sind schon wieder fertig. Vielleicht kommt es noch Ende des Jahres.
Das ist schon bald. Du du hast bereits des Öfteren gesagt, dass es bei deiner Musik um den Ausdruck von Gefühlen geht. Gibt es ein bestimmtes Gefühl, das durch „Alpha“ führt?
Ich habe lange nach dem Narrativ für „Alpha“ gesucht, unterschiedliche Dinge und Stile ausprobiert – live, als DJ und im Studio. Aber der Kleber, der alles zusammenhält, besteht in den modularen Synthesizern, die ich benutzt habe. Dadurch bekam der Prozess des Musikmachens einen Jam-Charakter. Ich bin wieder dahin zurückgekommen, im Studio zu sitzen, auf Record zu drücken, Kabel umzustecken und an Knöpfen zu drehen. Ich habe einfach geguckt, wo mich dieser Sound hinführt. Diese spielerische Herangehensweise hat mir dabei geholfen, den Sound des Albums zu finden. Aber ein bestimmtes Gefühl kann ich nicht definieren. Es gibt keine wirkliche Story. Entscheidend war, dass ich mich mit meinem Setup und der Musik wohlgefühlt habe. Es hat sich Selbstbewusstsein und auch ein bisschen Stolz hinsichtlich des Sounds eingestellt.
„Alpha“ ist also mehr ein Ergebnis aus Jam-Sessions als frühere Releases?
Ja. Und innerhalb des Jams die Form zu finden und diese Form den weiteren Verlauf einer Session bestimmen zu lassen. Das ist es, worum es geht.
Wie produzierst du ganz konkret? Du sammelst Sounds und arrangierst sie dann digital?
Ungefähr so, ja. Im Track „Destroyer“ gibt es zum Beispiel dieses Arpeggio, das sich wiederholt, wächst und verändert. Ich saß morgens in meinem Studio vor den Maschinen und habe Kabel an der Patchbay ein-, aus- und umgesteckt. Irgendwann habe ich genau diesen Sound gefunden und dachte gleich: Wow, das ist cool! Also habe ich am Computer auf Record gedrückt und habe sechs oder sieben Minuten auf diesem Sound gejammt. Danach dachte ich: Ok, das ist der Song. Das Main-Riff ist da. Von dort aus habe ich dann Kickdrum, Hi-Hats, Claps und so weiter eingefügt. Ich hab das Arrangement ein bisschen editiert, um es dichter zu bekommen. Aber was du im Track hörst, ist im Prinzip in dieser einen kurzen Jam-Session entstanden.
Audion, Alpha, ist auf !K7 erschienen. Album bei iTunes
Letztes Jahr begann mir dieser cleane und oft melodische Techhouse-Sound langsam aber sicher auf die Nerven zu gehen. Man rast von Drop zu Drop. Die hypnotische Komponente von Techno geht dabei völlig verloren. Ich habe wirklich gehofft, dass 2016 wieder mehr roughe und straighte Technomusik den Weg an die Oberfläche findet. Jetzt kommst du mit „Alpha“ und auch Lone geht mit seinem aktuellen Album wieder zurück zum Rave. Ohne euch beiden miteinander irgendwie vergleichen zu wollen: Glaubst du, es gibt wieder eine größere Sehnsucht nach dieser eigentlich weit zurückliegenden Sound-Ästhetik?
Ich hoffe es. Es gibt immer Leute, die eher traditionell und klassisch Techno produzieren. Ein schmaler Grat: Wir können mit Technologie ja so viel machen. Das Digitale ist so präzise und effektiv. Aber dadurch wird irgendwann das erreicht, was du ansprichst. Wenn du zu vorsichtig wirst, zu technisch, dann kommst du schnell in diese vorhersehbaren Rise-and-Fall-Situationen, die vom Publikum mittlerweile auch erwartet werden. Jeder will in dem Moment etwas fühlen, was er kennt: Der Bass kommt rein, immer dann, wenn die Leute es ahnen und sie drehen durch. Aber wenn du dann doch mal etwas Organischeres, Spontaneres hörst, dann hast du diesen Aha-Moment: Wow, das klingt anders. Es klingt unique. Und du kannst es natürlich trotzdem gut klingen lassen. Wenn du beides mixt, dann hast du ein tolles Rezept für interessante Dinge. Und genau das wollte ich auch: Mein Wissen über Klang einbringen, die richtigen Bassfrequenzen, die richtigen Mixing-Levels, und das mit diesem Jam-Techno kombinieren (lacht).
Das verschiebt ja auch den Fokus. Es geht nicht mehr so um Catchyness, sowohl was die Tracks ingesamt angeht, als auch auf einzelne Momente innerhalb des Stücks. Dafür atmet der Sound insgesamt viel mehr.
Stimmt. Und ich auch nie ein besonders guter ... wie soll ich sagen ... Komponist. Ich schreibe keine catchy Songs. Auch als Matthew Dear geht es mir nur um das Experiment, den Prozess des Musikmachens. Ich bin kein Typ, der mit einer Hit-Idee kommt und daraus einen Song macht.
„Mouth to Mouth“ ist schon verdammt catchy.
Aber rein zufällig entstanden. Ich bin nicht morgens aufgestanden, um diesen Popsong zu machen (lacht).
Du hast ein Remix-Album für „Mouth to Mouth“ in Auftrag gegeben. Welcher ist dein Lieblingsremix?
Harte Frage. Du willst du mich reinreiten (lacht). Nein, die Wahrheit ist: Alle Remixer haben etwas komplett Einzigartiges gemacht. Das ist jetzt eine sehr demokratische Antwort, sehr „Ich-bin-nett-zu-jedermann“. Aber ich glaube wirklich, dass jeder Remix auf seine eigene Art besonders ist. Carl Craig hat so einen großartig nach Detroit klingenden, cineastischen Karaoke-Remix gemacht. Der Mix von Boyz Noize hingegen ist eher ein perfekter Edit. Dance&Peak hat einen klassischen, verrückten Kick-Drum-Techno-Remix daraus gemacht, Riva Starr einen chuggy, loopigen House-Remix gebastelt. Ich hab im Vorfeld auch gesagt: Habt keine Angst, macht euch keine Sorgen, irgendeinem Original gerecht werden zu müssen. Macht einfach, macht euer eigenes Ding. Haben sie dann auch.
Stehen deine beiden Künstler-Identitäten in einem bestimmten Verhältnis zueinander?
In dem, was ich als Matthew Dear mache, steckt – glaube ich – auch ein bisschen mehr Matthew Dear. Das bin noch mehr ich. Da sitze ich in meinem Studio, setze meine eigene Stimme ein. Da kann aber auch eine Gitarre oder ein Synthesizer mit reinkommen. Es gibt keine Regeln. Die Musik als Audion hingegen ist immer noch für den Dancefloor gemacht. Ich habe ein bestimmtes Setting im Kopf. Und Vocals, vor allem meine eigenen, passen da nicht unbedingt. Audion zeigt nie sein ganze Gesicht, ein Teil bleibt immer verborgen, mysteriöser. To keep it simple: It's Techno. Audion ist meine Art der Tanzmusik, das, was ich darunter verstehe.

Wenn du mit einem Stück beginnst, weißt du bereits bereits, ob Audion oder Matthew Dear dahintersteckt.
Ja schon. Manchmal dreht es sich dann aber doch. Ich denke, ich mache einen Audion-Song, treffe dann aber einen bestimmten Akkord, eine bestimmte Note oder Abfolge, die catchy klingt. Und dann denke ich: Ah warte, ich mach das mal langsamer, drehe das Tempo zehn oder fünfzehn BPM runter. Ich hole meinen Bass raus, spiele eine Bassline darüber und schon ist aus Audion plötzlich Matthew Dear geworden. Das ist schon oft passiert.
Du bist zurück nach Michigan gezogen. Gibt es eine Verbindung zwischen der Rückkehr nach Michigan und der „Rückkehr“ zu Audion?
Nicht wirklich. Ich habe zwei junge Töchter und für Familien ist es dort einfach besser. Es ist ein toller Ort, um Kinder großzuziehen. Und es fühlt sich auch wirklich gut an – auch sehr kreativ. Ich baue aktuell ein neues Studio bei mir zu Hause, hoffentlich kommt da also noch sehr viel mehr Musik. Die Tatsache, dass ich mich hier an diesem alten, neuen Ort wohl fühle, hat bei der Fertigstellung des Audion-Albums geholfen.
Du warst zehn Jahre raus aus Detroit. Was hat sich verändert?
Einiges! Wir hatten jetzt gerade das Movement-Festival. Das gibt es seit vielen vielen Jahren. Als ich während des Festivals in die Stadt gefahren bin, dachte ich: Wow! Es sind schon immer viele Leute gekommen, aber dieses Jahr dachte ich zum ersten Mal, dass sich das Festival zu einer großen Nummer entwickelt hat. Sonst hatte man immer das Gefühl, es sei ein Festival für die „Die hard“-Techno-Fans zwischen Ost- und Westküste. Aber jetzt kommen Leute aus aller Welt, interessieren sich für Detroit und was dort passiert. Es hat sich wirklich jung und frisch angefühlt, nach positivem Vibe. In musikalischer Hinsicht war das Festival exzellent kuratiert, gleichzeitig fanden so viele Partys und Events statt. Über drei Tage gab es Label-Events in der ganzen Stadt. Aber auch in der Stadt selbst passiert viel: Unzählige heruntergekommene Häuser werden renoviert, bekommen neue Fenster, Baulichter erhellen das Innere. Man sieht echte Veränderung, auch in der Struktur der Stadt. Die Wirtschaft kommt voran, es gibt jetzt zum Beispiel einen riesigen Nike-Store in Downtown. Hätte mir das jemand vor fünf Jahren erzählt, wäre mir die Kinnlade bis zum Boden gefallen. Sogar eine neue Bahnlinie wird gebaut, um Downtown mit den Vororten zu verbinden.
Gerade hier in Europa, Deutschland und besonders eben Berlin, gibt es diesen romantischen Blick auf Detroit. Die Menschen sehen Bilder aus der Stadt und denken an Berlin in den 90ern – mit all dem Freiraum und den Möglichkeiten. Was du sagst hört sich an, als wäre da tatsächlich etwas dran.
Auf jeden Fall. Es gibt immer noch überall Graffiti, Tauben, die ganze Häuser bevölkern und Müll, der seit fünfzig Jahren nicht angefasst wurde. Der Weg ist lang, aber ich gebe dir ein Beispiel: Letzten Freitag habe ich eine Party im City-Club veranstaltet und die ganze Nacht gespielt, von elf Uhr abends bis sechs Uhr morgens. Ich hab meine Modulars mitgebracht und eine Art One-Man-Show gespielt. Um halb sieben bin ich durch die Location gelaufen, die Bar machte gerade zu. Und in der Main Area ist es völlig dunkel, alles ist voll mit Graffiti und Stickern und mir ist klar geworden: Sowas findest du sonst nirgends in den USA. Einen Club, den es seit den 80ern gibt, in dem damals schon Punk-Bands spielten. Es hat sich nach alter Zeit, nach alter Generation angefühlt. Hollywood könnte kein besseres Set designen. Du kannst diesen Look nicht faken.
Gefällt dir das, Sets mit einer Länge von sechs oder sieben Stunden zu spielen?
Manchmal (lacht). Einmal alle paar Monate. Das letzte Set hängt jedenfalls immer noch nach. Ich bin einfach zu alt, um sieben Stunden an der gleichen Stelle zu stehen.

In Sachen Artworks bleibt sich Audion treu.
Das gibt es ja auch immer seltener: einen DJ die ganze Nacht lang. Hier in Berlin, soweit ich weiß, nur noch am Mittwoch im Watergate. Ich mag das Konzept sehr, diese Sets erzeugen immer noch eine besondere Atmosphäre. Morgens geht die Sonne auf, scheint in den Club und man schaut in die Gesichter: Alle sind zerstört von der Nacht, die Gäste, aber eben auch die DJs. Und das schafft eine andere Atmosphäre als die reguläre Clubnacht, wo ein Set das andere jagt.
Auf jeden Fall! Als DJ ist es auch toll, von Beginn an zu spielen. Du kennst die erste, aber auch die letzte Platte. Und du kannst den Abend komplett musikalisch strukturieren und Energie auf bestimmte Momente hin erzeugen. Noch viel mehr sogar, als wenn du B2B mit einem Freund spielst oder so. Nur ein Kopf bestimmt, das ist besonders. Ich liebe es, um 11 Uhr abends einen leeren Dancefloor zu bespielen. Du kannst die Stimmung und den Vibe des Abends setzen, aber auch spielen, was immer du willst. Ich hab letzte Woche einfach mit ein paar Modular-Loops angefangen, 115BPM und ein paar Drums und Synth-Sounds auf dem Sequencer. Und es ist unglaublich befreiend als DJ, zu wissen: Du hast noch die ganze Nacht vor dir.
Visuals sind dir immer extrem wichtig. Egal ob es um deine Alben, deine Shows oder das Label Ghostly geht. Was müssen gute Visuals in Verbindung mit Musik leisten?
Für mich ist das mit der Zeit der Musikvideos der 80er und 90er verknüpft. Damals gab es eine sehr sehr direkte Verbindung zwischen dem was du siehst und hörst. Ich sage nicht, dass jedes Stück Musik einen visuellen Konterpart braucht. Aber wenn es den gibt, hast du eben auch einen weiteren Sinn eingebunden, Sound wird zur bildlichen Vorstellung. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der deutschen Band Can aus den 70ern. Würde ich diese psychedelischen, verrückten, mysteriösen Artworks nicht kennen, wäre meine Idee dieses Sounds eine völlig andere. Mit Visuals hilfst du dem Narrativ im Kopf des Zuhörers, lenkst in eine bestimmte Richtung: So sieht meine Musik aus! Aber du musst es richtig machen. Wenn es nämlich nicht passt, brennst du den falschen Eindruck in den Kopf des Zuhörers oder Betrachters. Und der wird dann für immer damit leben müssen.