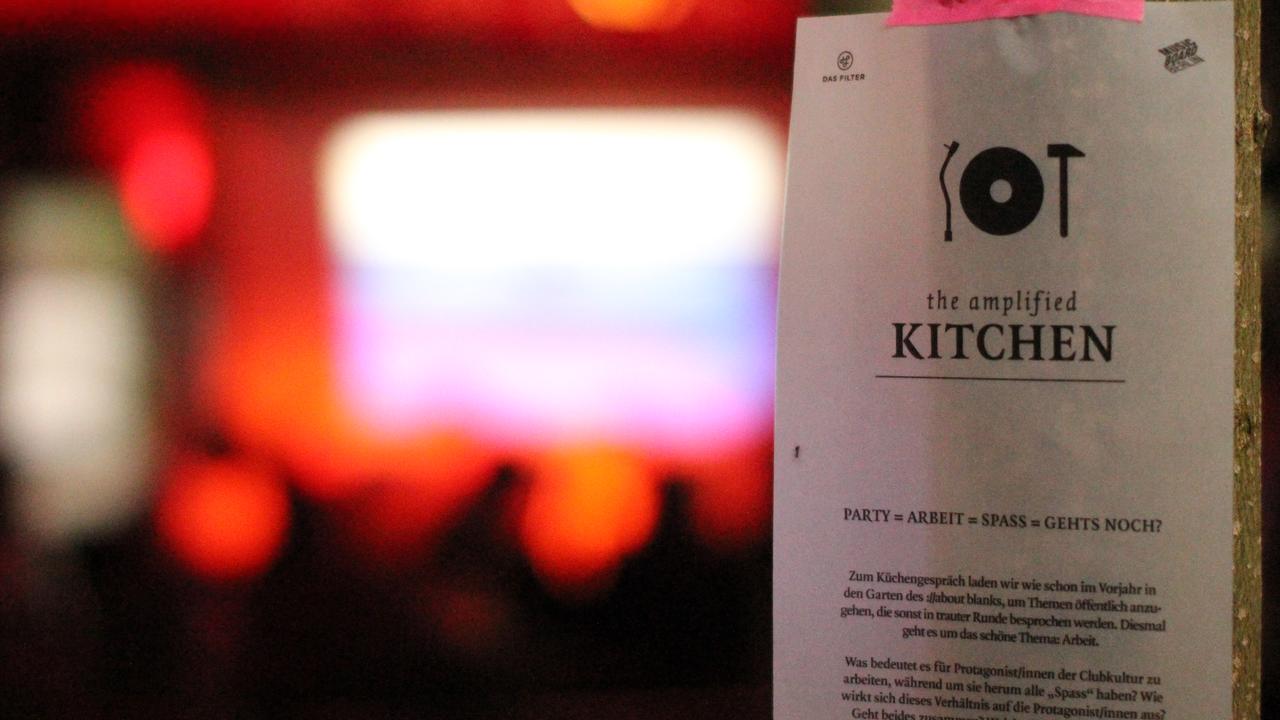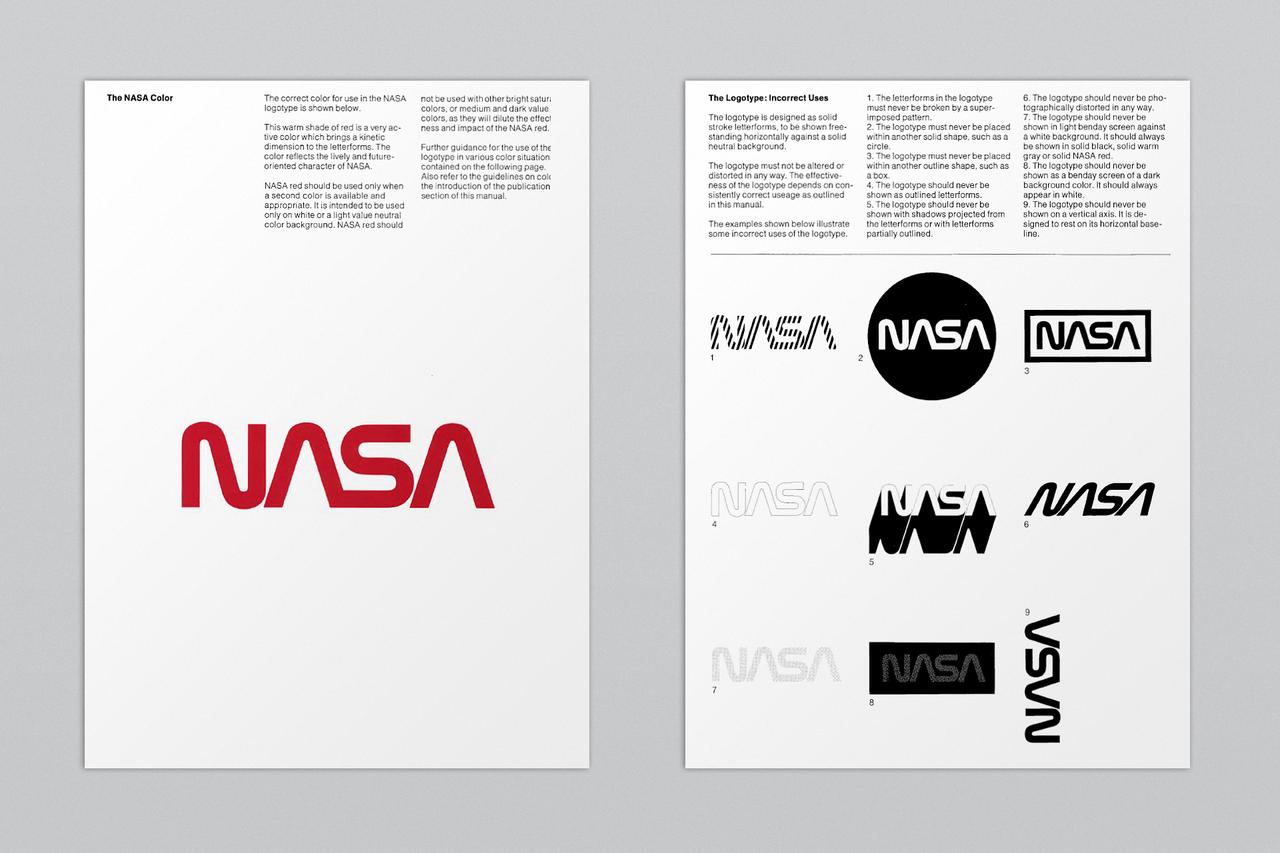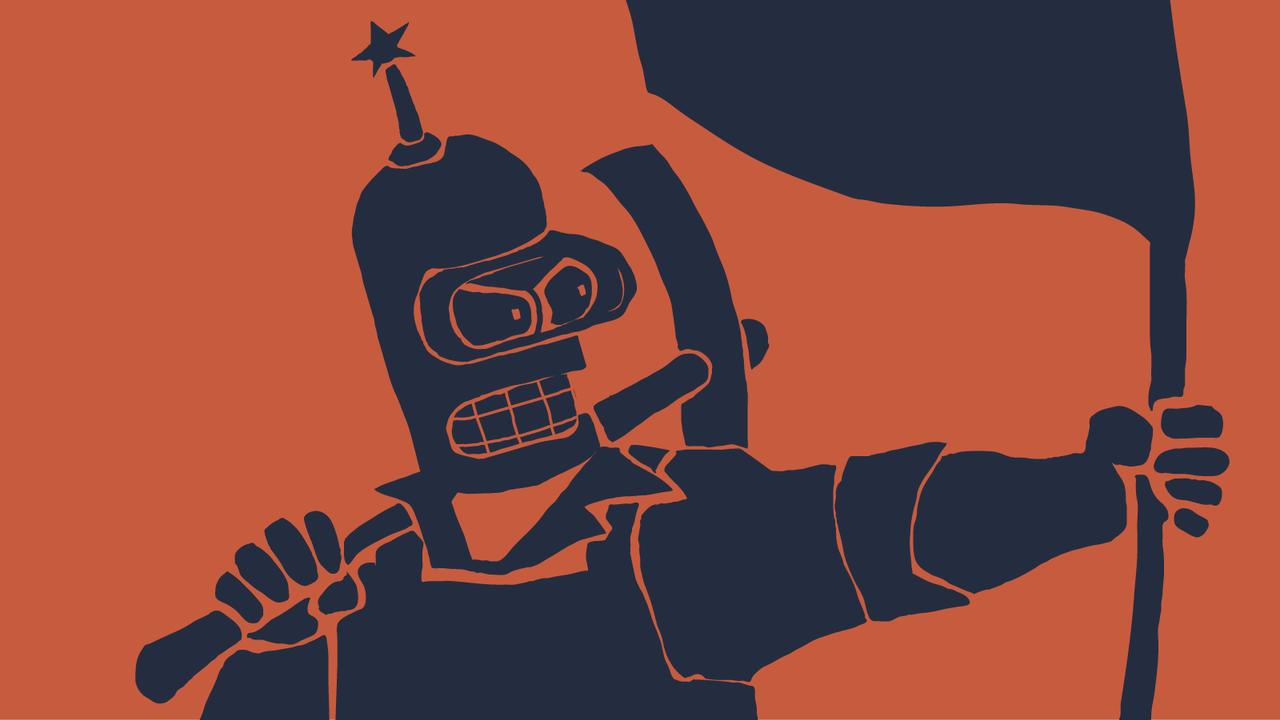Kaum ein Wort wurde in der Clubkultur je größer geschrieben als „Toleranz“. Gleichzeitig mangelt es genau daran in der Gesellschaft – siehe Heidenau, siehe Freital. Lässt sich die oft gepredigte Toleranz in der Clubkultur für gesellschaftliche Veränderungen nutzen? Können Menschen durch Clubkultur politisiert werden? Oder ist der Toleranzbegriff eh nur eine gern benutzte, im Kern aber inhaltsleere Floskel? Um diese Fragen ging es bei der vorerst letzten Diskussionsrunde von „The Amplified Kitchen“ im Garten des Berliner Clubs about://blank Mitte September.
Für alle, die bei der Diskussionsrunde nicht dabei sein konnten oder den Abend noch einmal Revue passieren möchten, gibt es hier den vollständigen Audio-Mitschnitt, so wie eine editierte Transkription des Gesprächs mit Elena Woltemade, Friederike Krebs und Mark Terkessidis.
##Über die Teilnehmer
Mark Terkessidis: Popkulturtheoretiker und ehemaliger Redakteur der Spex. Heute ist er auch als Migrations- und Rassismusforscher tätig und hat kürzlich das Buch „Kollaboration“ beim Suhrkamp-Verlag veröffentlicht.
Friederike Krebs: U. a. Gedenkstättenpädagogin und Mitwirkende der Initiative Bewegungsfreiheit. Auch in Flüchtlingsaktionen rund um den Berliner Oranienplatz ist sie involviert.
Lena Woltemade: House-Veteranin, aber auch bei Aktionen wie „Bewegungsfreiheit“ aktiv. Außerdem geht die Aktion „Atomkraft wegbassen“ auf ihr aktivistisches Konto.
Mark, das Eis der Political Correctness ist dieser Tage sehr dünn. Wenn wir von der jetzigen Flüchtlingskrise sprechen, auch aus Sicht akademischer oder wissenschaftlicher Migrationsforschung, wie ist die Situation, die uns heute auf allen Kanälen entgegenschlägt, tatsächlich einzuschätzen? Wie groß ist der vermeintliche Ausnahmezustand wirklich?
Mark Terkessidis: Das ist ein riesiges Thema. Der relevante Ausgangspunkt ist der, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offenbar nicht in der Lage war, zu erkennen, dass sich die Situation vor etwa einem Jahr dramatisch verändert hat. Die Behörde hat zwar 2.800 Mitarbeiter, konnte aber nicht erkennen, dass es einen Bürgerkrieg in Syrien gibt. Darüber hinaus funktioniert der Cordon Sanitaire, den die BRD mit dem Dublin-Abkommen um sich selbst [bzw. die EU, Anm. der Redaktion] gelegt hat, nicht mehr. Demnach sollten die Flüchtlinge nämlich dort einen Asylantrag stellen, wo sie die EU betreten. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Deutschland während der Griechenland-Krise ein gewisses Auftreten gezeigt hat, sodass die südlichen Länder – Griechenland und Italien – keine Lust mehr haben, sich an dieses Abkommen zu halten und den Transit der Flüchtlinge ermöglichen. Außerdem gibt es offenbar einen Konflikt zwischen der EU und der Türkei, der nicht wirklich thematisiert wird. Früher hat die Türkei Flüchtlinge davon abgehalten, zum Beispiel nach Kos zu gehen. Das tut sie mittlerweile nicht mehr.
Das heißt, es gibt ein erhöhtes Aufkommen von Flüchtlingen. Ich halte es aber für dramatisch verfehlt, von einem Notstand zu reden. Das ist Vokabular, das wir noch aus den 90ern kennen. Wir haben keinen Notstand. Die Zahl von 800.000 Flüchtlingen, die das Bundesamt herausgegeben hat, ist eine Zahl, von der man nicht weiß, auf welcher Grundlage sie zustande gekommen ist. Bis Juli haben 200.000 Menschen Asylanträge gestellt. Jetzt sind sehr viele Leute gekommen, die bereits vor Antragsstellung nach dem sogenannten ISI-Verfahren auf die Länder verteilt wurden. Jetzt haben sie festgestellt: Es sind 300.000 Leute, die einen Asylantrag stellen können. Das war der Stand Ende Juli. Das heißt, in den ersten sieben Monaten sind 300.000 Menschen gekommen. Das Bundesamt geht jetzt davon aus, dass sich die Zahl der monatlich kommenden Flüchtlinge verdoppeln wird. Warum sollen aber im Dezember doppelt so viele Flüchtlinge kommen wie im Sommer? Das ist eigentlich völlig unrealistisch. Ich habe beim Bundesamt angefragt, ob es ein Prognose-Verfahren gibt. Gibt es nicht. Das ist schon lustig, die Zahl wird also faktisch pi mal Daumen geschätzt, von den Ministerpräsidenten noch erhöht und ist jetzt Argumentationsgrundlage. Damit wird also der Notstand erklärt, was jetzt dazu führt, dass sich Kommunen, Länder und Bund gegenseitig die Verantwortung zuschieben.
Was aber passiert, wenn der Notstand ausgerufen wird und der Staat nicht zurechtkommt? Menschen nehmen Dinge selbst in die Hand. Das hat zwar positive Auswirkungen – viele wollen helfen –, aber in Heidenau nehmen die Leute die Dinge eben auf andere Art und Weise selbst in die Hand. Durch diesen Notstand auf der einen Seite, das nicht funktionierende Bundesamt für Migration auf der anderen Seite, entsteht eine problematische Situation. Dazu kommen staatliche Stellen, die sich die Verantwortung hin- und herschieben, und eine Hilfsbereitschaft, die ich zwar begrüße, die auf der anderen Seite aber auch auf diesem traditionellen Bild basiert, das wir ein moralisch unambivalentes Opfer haben: Bürgerkriegsflüchtlinge, die arm dran sind. Hinzu kommt der der Mythos, dass aus Syrien lauter Ingenieure und Rechtsanwälte hier ankommen, die schnell in den Arbeitsmarkt gelangen. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Diese Situation kann morgen schnell wieder umschlagen, sobald sich herausstellt, dass die Menschen sich nicht nur als arme Opfer erweisen, sondern Ansprüche stellen oder Fehlverhalten zeigen, was auch immer das konkret heißen mag. Es ist prekär.
Es gibt also Missverständnisse, auch medial transportierte Missverständnisse. Können wir versuchen, die zu skizzieren? Wo siehst du die noch?
Mark Terkessidis: Der Punkt ist: Es liegt eine Situation vor, in der der Staat nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Dann gibt es ein Missverständnis, dass sich aus einer Neuorientierung heraus ergibt. In der Asylpolitik gab es Anfang des Jahres eine Art Paradigmenwechsel. Deutschland hat sehr lange darauf bestanden, die Flüchtlinge vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Das heißt, man hat eine zentrale Unterbringung angestrebt und die Flüchtlinge durften sehr lange nicht arbeiten. Man hat ihnen eine autoritäre Fürsorge erteilt. Das hat sich Anfang des Jahres durch das Anerkennungsgesetz geändert. Es gibt einen Umschwung: schnelle Integration in de Arbeitsmarkt. Das ist zunächst begrüßenswert. Man kann zwar eine Nützlichkeitsdebatte darüber führen, aber die Situation für die Betroffenen hat sich konkret verbessert – auch durch die schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen. Die dezentrale Unterbringung war auch eine gute Sache, die jetzt allerdings durch die schiere Menge der Menschen konterkariert wird. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Ziel. Vom Prinzip her ist die Flüchtlingspolitik also nicht ausschließlich in die falsche Richtung gegangen. Wenn nun aber der Mythos kursiert, dass da lauter Rechtsanwälte und Ingenieure kämen, steht man vielleicht morgen vor einem Problem, wenn sich nämlich herausstellt, dass doch nicht alle so super ausgebildet sind. Die Diskussion, ob der Mindeslohn für die Flüchtlinge nicht ausgesetzt werden sollte, läuft ja bereits. Da bin ich absolut dagegen.
Man hat den Eindruck, dass einfach kurzfristig gedacht wird. Wir haben ja eben schon Heidenau bzw. den Rechtsradikalismus in Sachsen erwähnt. Es gibt aber auch strukturellen Rassismus, Hate-Speech auf Facebook und in anderen sozialen Netzwerken. Was ich auch sehr spannend finde: Im Rahmen der Aktivitäten rund um den Münchener Bahnhof, kam es auch zu eindeutigen Problemen mit positivem bzw. Alltagsrassimus. Es gab zum Beispiel einen Artikel in der SZ, in dem darüber berichtet wurde, dass ein Mädchen – türkischer Abstammung, aber in Deutschland geboren – mit Kuscheltieren überhäuft wurde, bevor sie das nächste Auffanglager aufsuchen sollte. Wie rassistisch ist Deutschland wirklich? Ist diese Darstellung der Vielschichtigkeit anders als zuvor?
Mark Terkessidis: Der Rassismus wird dadurch ja nicht besser. In Deutschland kommt hinzu, dass es ein relativ junges Einwanderungsland ist: Seit rund 100 Jahren gibt es das Phänomen, seit den 1960ern gab es die geförderte Einwanderung. Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung erst 1998 erstmalig anerkannt, dass es einen unumkehrbaren Prozess der Zuwanderung gibt. Mit der Änderung der Staatsangehörigkeit gab es dann 2000 einen richtigen Umschwung. Man verstand Deutschland fortan als Einwanderungsland mit einer neuen Zusammensetzung der Bevölkerung. Die besteht nicht nur aus ethnischen Deutschen, sondern auch aus Menschen mit Migrationshintergrund. Ansonsten ist man aber immer noch der Idee von der Einwanderung als temporäre Erscheinung ausgegangen. Davon, dass diese Menschen eine Willkommenskultur brauchen. Das galt auch für alle, die in der x-ten Generation hier leben. Diese Verwechslung aufgrund des Aussehens ist also gar nicht so unerwartet, ruck zuck ist man der ewige Neuankömmling. Außerdem tut sich Deutschland weiterhin extrem schwer mit einer ordentlichen Antidiskriminierungsgesetzgebung. Die ist extrem entschärft worden. Auch was Behörden und Ämter betrifft, hat man sich kaum auf eine vielfältige Bevölkerung eingestellt. Es gibt keinerlei Versuche, die Gesetze so zu entmisten, dass sie unserer vielfältigen Bevölkerung gerecht werden.
Im Alltag kann man aber durchaus Veränderungen feststellen. Vergleicht man neue Untersuchungen zum Thema Rassismus mit denen aus den 90er-Jahren, stellt man fest, dass es damals noch einen richtigen völkischen Rassismus gegeben hat. Da haben die Leute gesagt: Das deutsche Volk wird biologisch zerstört – durch Einwanderung. Das würde heute kaum noch jemand sagen – nicht einmal bei der NPD ist man dieser Auffassung. Es gibt jetzt eher eine Eindämmungsstrategie. Und es gibt ein Stadt-Land-Gefälle. In den Städten ist solch „rassistisches Wissen“ mehr zurückgegangen, als in ländlichen Gebieten, wo relativ wenig Leute mit Migrationshintergrund leben: das ländliche Bayern, das ländliche Niedersachsen, das ländliche NRW, die neuen Bundesländer. Die Tatsache, dass in Leipzig über eine angebliche Islamisierungswelle gesprochen wird, ist umso absurder, wenn man sich anschaut, wie viele Leute mit Migrationshintergrund denn überhaupt in Leipzig wohnen. In Frankfurt am Main haben 65 Prozent der Kinder unter sechs Jahren Migrationshintergrund. In anderen großen Städten in Westdeutschland ist es ähnlich. Dort haben fast zwei Drittel der Kinder mindestens ein Elternteil, der selbst noch eingewandert ist. In Dresden sind es 2,5 Prozent oder so, in Leipzig vielleicht zehn.
Bevor es nun konkret um Clubkultur gehen soll, eine letzte Frage: Du hast ja gerade die Geschichte von Deutschland als Einwanderungsland beschrieben. Man kann nicht davon ausgehen, dass viele der Flüchtlinge das Land in den kommenden fünf bis zehn Jahren wieder verlassen. Wie groß ist die Gefahr, dass die Politik die gleichen Fehler macht wie bei den letzten Einwanderungswellen.
Mark Terkessidis: Das kann ich nicht genau sagen. Einen wesentlichen Unterschied gibt es: Man sieht den Aufenthalt von Menschen aus Syrien oder Erithrea nicht als vorübergehend an. Das hat die Kanzlerin ja sogar öffentlich geäußert, woraufhin noch mehr Leute gekommen sind. Die Anerkennungsquoten sind sky rocketing. Letztes Jahr lag sie bei 2,5 Prozent, jetzt bei fast 40 oder 50 Prozent. Und die anerkannten Flüchtlinge dürfen bleiben. Das ist, glaube ich, auch präsent. Das gilt allerdings nicht für die Menschen aus Albanien, Mazedonien oder Bosnien. Die bekommen mittlerweile innerhalb einer Woche einen Ablehnungsbescheid mit der Ausreiseverpflichtung. Diese Leute kommen aber auch aus den unterschiedlichsten Gründen: Sie sind krank oder bettelarm. Manchmal wollen auch nur den Sommer oder Winter hier verbringen. Aber ansonsten gibt es die Orientierung, dass die Menschen hier bleiben und auch relativ schnell auf den Arbeitsmarkt kommen. Das ist anders als vorher. Ich sehe schon mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft – im Vergleich zu früher. Aber diese Ideen von„ armen Opfern“ sind immer problematisch. Das kann sehr schnell umschlagen. Das sind keine Opfer, sondern Menschen, die mit einer Perspektive in dieses Land kommen. Sie haben etwas vor und werden auch Ansprüche stellen. Und dann schlägt die Stimmung relativ schnell um.
Elena und Friederike. Ihr habt euch immer darum bemüht, politischen Aktivismus in den Kontext von Club- und Popkultur, von Techno und Musik zu bringen. Erzählt doch zunächst etwas über eure Arbeit. Was war damals die Intention so etwas zu machen und wie ordnet ihr diese Art des Aktivismus heute ein?
Friederike Krebs: Mir ist gerade nochmal meine Berlin-Geschichte bzw. meine Techno-Geschichte eingefallen. Lange dachte ich, Techno sei so eine Mainstream-, Kommerz-, Prollgeschichte. Als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich gesehen, dass es eine Subkultur gibt: Das war mein Einstieg. Wir haben auch schon im Jahr des letzten Castor-Transportes – 2009 – eine Soliparty gemacht. Im Zuge der Refugee-Bewegung, die ja so seit zwei Jahren in Berlin existiert, war ich von Anfang an dabei. Die Geschehnisse am Oranienplatz, die Besetzung der Hauptmann-Schule, das ist ja alles schon etwas länger im Gange. Wir haben Schichten auf dem O-Platz geschoben und darüber nachgedacht, was man noch machen kann – auch im Bezug auf Clubkultur. Nicht zuletzt auch deshalb, weil uns die damals schon sehr entpolitisiert vorkam, andererseits aber auch viel Geld in Umlauf ist, gerade in Berlin. Dieses Geld wollten wir nutzen, weshalb wir vor fast eineinhalb Jahren die Initiative „Bewegungsfreiheit“ gegründet und die ersten Partys organisiert haben. Das ist nun schon eine Weile her. Und dann wird maplötzlich n überrollt, wenn der große Aktivismus in den Medien beginnt. Da fühlt man sich dann auch ein Stück weit verarscht.
Elena Woltemade: Bei mir lief das anders. Ich komme aus einer Zeit, in der Ecstasy und Antifa-Demo nicht zusammenpassten – wahrscheinlich auch zurecht. Selbst Alkohol war auf Demos früher ja schon ein Problem. Ich mag die Demo als Aktionsform auch mehr als Soli-Partys. Die feiert man später, wenn akut Geld fehlt. In Oldenburg sollte mal eine Nazi-Demo stattfinden, da mussten gleich mehrere Gegenveranstaltungen angemeldet werden, weil nicht klar war, wo die Nazis eigentlich sind. Ich war für einen dieser Kundgebungspunkte verantwortlich und wusste gar nicht so richtig, wie das alles abläuft. Da habe ich mir überlegt, dass ein paar meiner Feier-Freunde da hinkommen sollten, weshalb ich dann einen Wagen gemacht und an diesen Kundgebungsort gestellt habe. In Berlin ging das dann weiter. Neben meinem Studium hatte ich vier Jahre lang einen Job im Bundestag, habe diese beiden Bereiche aber strikt getrennt. Als dann der Atomausstieg anstand, kam ein Kollege, so ein Kampagnentyp, auf mich zu und meinte: Diese Bewegung hat so einen langen weißen Bart, man müsste das funky machen, ein bisschen verjüngen. So haben wir „Atomkraftwerk wegbassen“ ins Leben gerufen. Erst nur für eine Demo, das war mir aber nicht genug. Ich wollte ins Wendland und habe dort mit den Hedonisten Kontakt gehabt. Wir haben versucht, diese bauchlinken Raver dorthin zu bekommen. Wir wollten dem ganzen aber einen Rahmen geben, der sie nicht gleich auf die Schlachtbank führt. Die Party kam dann erst hinterher, weil wir Kohle brauchten.
Du hast ja angedeutet, dass Ecstasy und Antifa lange Zeit gar nicht zusammen funktionierten. Geht das jetzt besser?
Elena Woltemade: Mir ist beim Feiern in den letzten Jahren aufgefallen, dass die meisten Menschen sich als links bezeichnen, was ich aber ziemlich hohl fand. Ich wurde vor einer Bundestagswahl von Bekannten angerufen und gefragt, was sie jetzt wählen sollen. Schön, dass ich hier die Polit-Alte bin, ist ja auch irgendwie süß. Oft waren das auch sehr schwammige Bekenntnisse wie: Ich bin links, weil ich vegetarisch bin. Ich habe dann auch am Wahlsonntag Leute in den Clubs getroffen, die dann gesagt haben: Eigentlich wollte ich noch wählen gehen, mache ich jetzt aber doch nicht. Die haben Nicht-wählen gar nicht als politische Aussage begriffen, sondern waren einfach verpeilt. So habe ich Clubkultur kennen gelernt. Ich freue mich, wenn vereinzelt Leute oder Kollektive – wie zum Beispiel das about://blank – mit konkreten Aussagen auftreten. Eine Zeit lang musste man Angst haben, ob die Leute bei sowas überhaupt positiv reagieren. Derzeit läuft das sehr gut, ist ja gerade auch en vogue. Man muss nur aufpassen, dass man damit gut umgeht, dass das nicht nur ein Hype ist. Aber man kann darauf aufbauen, wie das zum Beispiel „Bewegungsfreiheit“ macht.
Friederike Krebs: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Veranstalter und Clubs total offen sind. Ein Mitglied aus unserer Gruppe hat die Bezeichnung „Pink-Washing“ geprägt, oder auch „Political-Green-Washing“. Am Anfang hatten wir das Gefühl, dass es für die Clubs auch eine ganz willkommene Gelegenheit ist, sich jetzt so zu positionieren. Das ist erstmal ganz toll. Aber wie geht's weiter?

Es gibt gleichzeitig positive und negative Kritik, wenn zum Beispiel im Watergate gefeiert wird, um Geld für „Sea Watch“ zu sammeln. Mark, du bist ja Popkenner bist und kannst das mit Bewegungen wie Punk, Techno oder Disco in den 70ern vergleichen. Wie schätzt du solche Aktivitäten ein? Welchen Nachholbedarf gibt es, welche Potenziale – jenseits der Diskussion, ob Pop politisch sein kann oder nicht?
Mark Terkessidis: Disco war ja nicht politisch politisch. Nile Rodgers von Chic war mal Black Panther, aber das hört man Chic nicht unbedingt an. Der Punkt bei Disco ist: Da wurde ein Raum geschaffen, in dem subkulturelles Leben möglich war. In diesem Raum wurden Dinge zugelassen oder gefördert, die in der Gesellschaft abgelehnt und diskriminiert wurden. Der Club selbst war das politische Projekt, indem man einen demokratienahen Raum schafft, der anders funktioniert, als die Mainstream-Gesellschaft. Ein Teil des Protestpotenzials artikulierte sich über Stil, über Aussehen, über Tanzen. Und das hatte auch eine heilende Wirkung. Es ist natürlich heute immer noch möglich, einen Club so zu machen und ich würde auch weiterhin darauf bestehen. Auf der anderen Seite haben sich aber viele dieser Protest-via-Stil-Aktivitäten im Mainstream und in der Werbung festgesetzt. Urban Outfitters weiß heute genau, wie diese Art von Kommunikation funktioniert, wie sie gelesen und interpretiert werden soll. Und wie kreativer Konsum funktioniert. Die sind ja alle zu Fachleuten der Cultural Studies geworden, während sie eine Werbekampagne konzipiert haben.
Wenn es um die Repolitisierung der Clubkultur geht, stellt sich die Frage: Wie genau sieht die aus? Ich würde die Frage wie dieser Raum funktioniert weiterhin in den Vordergrund stellen. Ich weiß gar nicht, ob aus der Clubkultur eine politische Bewegung werden kann. Offenbar gibt es ein epidemisches Bedürfnis nach Engagement in der Gesellschaft – aber ganz häufig auf der Charity-Ebene. So schön ich das finde, so problematisch finde ich das auch. Das ist ja fast wie in den USA: In einer großen Firma gehört es einfach zum guten Ton nach der Arbeit noch in die Suppenküche zu gehen und dort Essen zu verteilen. Das europäische Modell war aber immer anders. Das bestand darin, dass man einen sinnvollen, politischen Rahmen für diese Situation findet und eine Institution schaffen will, die diesen Rahmen auch erfüllen kann. Wenn es jetzt eine Bewegung davon weg und hin zur Charity gibt, dann finde ich das nicht unproblematisch: Dass die Clubs sich jetzt für Flüchtlinge engagieren, kann morgen schon wieder vorbei sein. Die ganze Debatte hat noch eine Halbwertszeit von vielleicht zwei Monaten, dann sind alle gelangweilt. Es redet ja auch niemand mehr über Griechenland:
Ich weiß nicht, ob der Club der richtige Ort für das politisch politische Investment ist.
Ich sehe das ähnlich skeptisch. Es hat keinen Sinn, das über's Knie zu brechen. Es gibt eine Diskrepanz zwischen intendierter Inhaltsvermittlung und dem Feiergedanken. Ihr habt ja auch schon verschiedene Konzepte ausprobiert, wie sehen eure Ansätze aus?
Friederike Krebs: Du sprichst genau das Dilemma an. Die Ursprungsidee bestand darin, auch unpolitische Partygäste zu politisieren. Das wollen wir auch immer noch. Aber wir wollen nicht, dass das schlechte Gewissen quasi weggespendet oder -gefeiert wird. Deshalb beinhalten unsere Konzepte auch immer einen Awareness-Part. Wir versuchen, ein Awareness-Team zu organisieren und im Vorfeld schon zu sensibilisieren, dass wir keinen Rassismus und Sexismus haben wollen. Das kennt man auch schon aus den linken Szenen. Aber es ist doch was anderes, wenn man sowas dann im Watergate macht. Das mit dem Infostand hat nicht so gut funktioniert, er ist nicht wirklich frequentiert worden. Im Watergate war das noch viel unbedarfter. Auch die Tür kannte das Awareness-Konzept nicht. Die fanden das aber toll – und die Gäste auch. Da haben sich auch Gespräche entwickelt. Im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, inwiefern das überhaupt mit unserem Thema hier zu tun hat. Aber das war eben eine Idee von mir, wie man Partys strukturell politisieren kann und sollte.
Wie funktioniert das Awareness-Konzept konkret?
Friederike Krebs: Awareness heißt ja Bewusstsein. Es gibt ein Team, dass im Falle von sexistischen, rassistischen oder anders diskriminierenden Übergriffen als Ansprechpartner dient. Je nach Veranstaltung oder Location achtet das Team auch auf diese Sachen. Das ist eine relativ neue Idee, wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal versucht, das auf einem Festival umzusetzen. Da war vor allem die Aufklärungsarbeit wichtig. Weil das so neu ist, kommen Betroffene nicht unbedingt sofort auf einen zu. Aber die Aufklärungsarbeit, die Gespräche, die sich ergeben haben, waren sehr fruchtbar.
Elena Woltemade: Was ich daran spannend finde: Es ist ja auch eine gewisse Kritik an der eigenen Club- und Feierszene. Leute sind verdutzt und fragen sich, warum sowas denn in diesen superaufgeklärten Kreisen überhaupt notwendig sei. Ich stehe voll hinter dieser Notwendigkeit. Mir gefällt die Überraschung der Leute, die sagen: Was? Hier bei uns? Seit Monika Kruse „No Historical Backspin“ gemacht hat, sollte eigentlich klar sein, das Techno und Rave alles andere ist, als ein linkes Zusammenkommen.
Woran ist das deiner Ansicht nach gescheitert?
Elena Woltemade: Hat das jemals angefangen?
Das klang jetzt so, als hätte die Kampagne von Monika Kruse nicht so funktioniert, wie sie hätte sollen.
Elena Woltemade: Nein, Monika hat diese Partys ja gemacht, weil sie aus diesem Rave-Klüngel kam und auf größeren Veranstaltungen gemerkt hat, dass die Nazis mittlerweile mitraven. Da war sie angepisst und hat diese Veranstaltung gemacht. Sie war da schon eine der ersten, die das gemacht. Da sind wir auch beim Thema Charity und Soli-Party, ich finde das nämlich sehr sinnvoll. Ich finde die „Bewegungsfreiheit“-Partys toll, denn da geht es auch um illegalisierte Menschen und um Geld, das man vielleicht gar nicht offiziell weitergeben kann. Da werden Dinge durch die Clubszene möglich gemacht. Ich finde es immer problematisch, wenn es so eine feste Institution wird und dann ist es eben Charity. Ich benutze den Begriff Charity übrigens sehr viel und sehr gern in letzter Zeit, um auch mal zu zeigen, was das tatsächlich ist.
Mark Terkessidis: Die „No Historical Backspin“-Idee finde ich sehr gut. Anfang der 90er war man mit Hoyerswerda, Rostock, Solingen konfrontiert. Das hat auch mir nochmal so einen Politisierungsschub verpasst. Wir haben damals auch eine Tour in ostdeutsche Städte gemacht – „Wohlfahrtsausschüsse“ nannte sich das – und ganz klar darauf abgezielt, die Strukturen vor Ort zu unterstützen. Damals war völlig klar, dass sich so etwas wie eine geschlossene, rechte Sub- und Jugendkultur in den neuen Bundesländern entwickelt – und dass das niemand wirklich ansprechen und thematisieren wollte. Weder die Kommunen noch die Politik. Aber es gab natürlich Strukturen vor Ort, die versucht haben, etwas dagegen zu unternehmen. Dahinzugehen und was zu machen und das einzubetten in die örtlichen Strukturen ist eine sehr sinnvolle Sache.

In Hamburg hat vor kurzem ein Club namens Spendenclub aufgemacht. Die Idee: Der Club will Gewinne für bestimmte Zwecke spenden. Auch das geht eher in Richtung Charity. Die Art und Weise der Behandlung solcher Themen impliziert oft Begriffe wie Ablasshandel oder eben Greenwashing. Aber was man so einem Konzept ja zugutehalten müsste: Im Vergleich zur Soli-Party besteht eine gewisse Nachhaltigkeit und Konstanz.
Elena Woltemade: Da sehe ich ja das Problem. Die bekommen die Räume umsonst, das ist cool. Monatlich oder phasenweise haben die, glaube ich, ein Thema, das dann im Flur oder in den Toiletten aushängt. Dann bitten sie die DJs darum, weniger Gage zu nehmen oder zu spenden. Wenn ein DJ das nicht will, dann ist auch ok. Auch die Preise sollen normal sein. Ich finde das sehr absurd. Gespendet werden soll jetzt zum Beispiel an eine Dialysestation im Kinderkrankenhaus. Das ist aber nicht die Aufgabe von Charity oder von privaten Leuten. Politik und Gesellschaft entscheiden sich dafür, dass Kinder dort ordentlich versorgt werden. Aber es ist nicht ok, dass so der Eindruck entsteht, dass das über Charity zusammengekratzt werden muss. Und dass man so einen Club hat, bei dem man das Gefühl hat, da gehe ich hin und da wird irgendwas Gutes getan. Ich mag das gar nicht, sämtliche Themen in einen Topf zu hauen. Dann ist es nämlich irgendwann egal, ob man gegen Atomkraft, gegen Nazis oder für Biobauern ist. Dann hat man eben den Zustand wie in den USA, wo in Bewerbungen drin stehen sollte, dass man irgendeine Art von Charity gemacht hat. Ich finde es zwar sympathisch, aber die Richtung, die langfristig gesehen eingeschlagen wird, finde ich falsch.
Friederike Krebs: Ich kann dazu wenig sagen, weil ich das Projekt nicht kenne, denke aber auch immer wieder darüber nach, on wir nicht doch einen Verein gründen sollten. Aber dann erinnere ich mich doch wieder daran, dass wir als Nicht-Verein ganz anders agieren können, für Dinge spenden, für die man als Verein nicht spenden kann, weil dann wieder entsprechende Nachweise erforderlich sind etc. Merkwürdig fühlt sich das dennoch an. Wenn wir diese Partys gemacht und diesen Haufen Kohle vor uns liegen haben, geht es ja eigentlich erst los. Das Verteilen des Geldes ist eine ganz schön schwierige Aufgabe, denn dann muss man sich für und gegen Leute entscheiden, abwägen wer wie viel bekommt. Dann ist man auf einmal in so einer komischen, weißen Machtposition, in der man paternalistisch Geld an Bedürftige verteilen kann. Das kann ich auch nur machen, weil ich mich darüber hinaus noch engagiere – und eben nicht nur Soli-Partys mache.
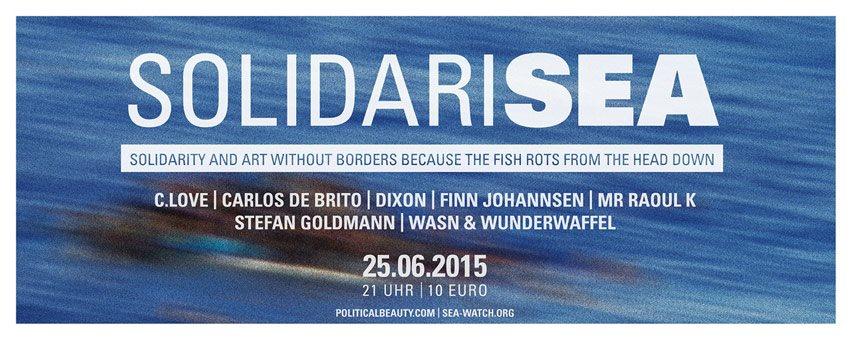
Wir sind ja auch hier angetreten, um nach weiteren Möglichkeiten und Strategien abseits von Soli und Charity zu suchen. Mark, du sagtest ja, dass es gar nicht so sehr um eine Attitüde oder eine Message geht – eine Technoplatte hat eben keine politische Aussage –, sondern vornehmlich um Räume. Wie kann sowas aussehen?
Elena Woltemade: Diese Frage ist ja schwarz-weiß. Ich sehe sehe das sehr ambivalent. Wenn ich sowas mache, ist zunächst wichtig, worum es mir geht. Warum kriege ich gerade meinen Arsch hoch und was ist die richtige Aktionsform? Bei der „Sea Watch“-Geschichte im Watergate stand ja auch gar nicht mehr das Geld im Fokus. Die schippern da mit einem Boot im Mittelmeer rum und es ist sehr wichtig, dass diese Menschen durch die öffentliche Aufmerksamkeit einen gewissen Schutz bekommen. Mit Frontex und Co ist es im Mitttelmeer gar nicht mehr witzig. Und das Watergate ist ein sehr guter Ort dafür. Dann kann eine Party im Club die absolut richtige Aktionsform sein. Ich finde es auch großartig, was hier regelmäßig im about://blank passiert. Es kann aber sein, dass ich bei einer bestimmten Aktion sagen würde: Naja, hier rennt man zwar eher offene Türen ein, aber im Umfeld dieses Clubs kann das Thema trotzdem noch vertieft werden. Dann ist das super. Es gab zum Beispiel schon immer Soli-Partys in Wagenburgen und die machen auch immer noch Sinn. Es kommt auch darauf an, wie groß das Projekt ist.
Der Club kann absolut der richtige Ort sein, aber eine Gruppe sollte immer ehrlich zu sich selbst sein und sich zunächst fragen: Warum machen wir das hier?
Da kann jeder ehrlich für sich sagen, was ihn antreibt, muss aber auch zugeben, dass er sich besser fühlt, wenn er etwas gegen schlechte Zustände tut. Dann muss darüber gesprochen werden, ob man diesen Zustand wirklich verändert oder ihn nicht sogar untermauert. Ganz zum Schluss kommt die Aktionsform. Das ist die Reihenfolge, in der ich sowas angehen würde. Ich bin in solchen Gruppen streckenweise schon mal anstrengend. Manchmal halte ich mich raus, weil ich diesen Move ganz geil finde, aber mich bei den ersten Treffen nicht schon mit den Leuten anlegen will, nur weil die gedanklich vielleicht noch nicht dort sind, wo ich bin.
Friederike Krebs: Die Antwort auf die Frage hat ja auch damit zu tun, was mein persönlicher Begriff von Politik ist. Wenn der feministisch ist und auch das Private politisch ist, dann ist natürlich auch mein Clubbesuch politisch. Man kann Aufmerksamkeit schaffen und informieren. Aber ich habe mich auch gefragt, wie man Leute direkt auf den Partys agitieren kann. Maillinglist, tragt euch ein! Oder: Es gibt gerade Schichten am Infopoint am O-Platz. Das klappt nicht so gut. Aber indirekt war es bei mir persönlich schon so, dass ich durch ein bestimmtes Berliner soziales Netzwerk, das der Clubkultur nahesteht, agitiert wurde. Da gab es nämlich einen Thread zum O-Platz und ich bin hingefahren.
Mark Terkessidis: In letzter Zeit ist man häufig damit konfrontiert, dass Leute etwas Gutes tun wollen. Die sind für den Weltfrieden und finden es auch blöd, wenn Leute böse zueinander sind. Das kann man sich sparen. Man muss eine Idee davon haben, was man eigentlich will. Ihr habt Bewegungsfreiheit gemacht, weil ihr etwas mit der sozialen Bewegung der Flüchtlinge und deren Forderungen zu tun habt. Daraus leitet sich dann ab, was man in so einem Club leisten kann. Wenn ich Geld für Flüchtlinge sammeln will, dann kann man das machen. Das ist aber Charity und nicht Politik. Da fehlt mir die Grundlage, der eigentliche Plan. Das andere ist die Frage der Räume: Wenn man einen Club aufmachen oder gestalten will, in dem Sinne, dass der inklusiv ist, dann muss man über sehr viele Dinge nachdenken. Aber auch da muss man wissen, was man will. Techno hat in den 90ern schon darunter gelitten, dass zwar die Liebe gepredigt wird, aber am Ende konnte keiner mehr unterscheiden, was diese Feierei von der anderen Feierei unterscheidet. Das ist dann irgendwann hohl geworden, weil es keine genauen Vorstellungen davon gab, wo man eigentlich hin will. Das ist übrigens eine Entwicklung, die viele Subkulturen durchlaufen haben. Ich glaube aber, dass es heute umso notwendiger ist, über diese Dinge nachzudenken. Man kennt diese Entwicklungen ja bereits, nur oft werden die Erfahrungen gar nicht aufgearbeitet. Ohne irgendeine Ahnung davon, was vorher mal gewesen ist, probiert man die gleichen Sachen aus, die vor 20 Jahren schon scheiße gelaufen sind. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Klar kann ich nicht einfach auf einer Homepage nachgucken, wie das damals gelaufen ist, aber trotzdem gibt es die gleichen Leute ja immer noch – zum Beispiel in Berlin.
Friederike Krebs: Die Leute haben sich frustriert zurückgezogen.
Mark Terkessidis: Nicht zwangsläufig. Ich glaube die würden sich freuen, wenn mal jemand vorbeikommen und fragen würde, wie das damals eigentlich war. Das wäre eine andere Form von Oral History, die nicht einfach nur die schöne Berlin-Techno-Geschichte aufschreibt.
Elena Woltemade: Eine Sache können die Partys auf jeden Fall leisten. Ich denke da auch gar nicht nur an Technopartys, sondern auch an Konzerte. Zecken-Rap ist gerade zum Beispiel angesagt. Es gibt tolle Punk- und HipHop-Acts, die schon länger bekannt sind. Die Stadt ist voll mit Touris, Studenten und Leuten, die hier herziehen und am Wochenende in die Clubs gehen. Und die auch kleine Acts und Läden abfeiern. Das kann man schon nutzen, um den Fuckfinger mal wieder sexy zu machen. Protest und Dagegensein macht ja auch mehr Spaß, wenn man das mit einem Grinsen und ein bisschen Power ausstattet. Ich würde das als positiv bewerten.
Es gab in den sozialen Medien Vorstöße von Menschen, die etwas bewegen wollen. Ein Vorschlag lautete zum Beispiel, das Gelände der Fusion für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Andere sagten wiederum, Soli-Partys seien scheiße, weil sie exklusiv sind. Man sollte doch zusammen mit den Flüchtlingen feiern. Wie beurteilt ihr solche Ideen?
Friederike Krebs: Das sind unterschiedliche Konzepte. Beides ist legitim. Man kann eine Party für Flüchtlinge machen und denen das Geld geben, man kann aber auch eine Party zusammen mit den Geflüchteten machen. Wir versuchen bei der „Bewegungsfreiheit“ ja auch die Flüchtlinge miteinzubeziehen. Die stehen nicht so dolle auf Techno, muss man sagen. Aber es gibt unglaublich viele Soli-Partys, auf denen zum Beispiel auch HipHop läuft. Bei der letzten Party hat zum Beispiel ein Flüchtling gekocht. Er darf ja nicht arbeiten, hatte dadurch aber die Möglichkeit, ein bisschen Kohle zu verdienen. So kann man die Leute auch miteinbeziehen.
Elena Woltemade: An sowas merkt man ja auch, inwiefern die Menschen, die Charity machen, in den Protesten verankert sind. Ich glaube, dass sind auch am ehesten die Leute, die ihr eigenes Konzept infrage stellen oder verändern. Selbstkritik ist wichtig. Und die fehlt mir gerade ein bisschen. Freunde von mir sind jetzt nach Ungarn gefahren – was ganz toll ist –, sind zurückgekommen und wollen gleich nochmal hin, mit mehr Leuten. Jetzt machen sie alle zwei Tage Meetings und zerfleddern sich in Orga, wollen ein Wohnmobil mieten. Und jetzt heißt es: In drei Tagen müssen wir wieder hin. Elli, mach unser Backoffice. Ich ich sage dann: Nee, ich finde das schräg, was ihr da fabriziert und es ist gerade keine Zeit dafür. Ich finde euer Engagement geil, aber ich denke darüber nach, wie viel Sinn sowas macht. Ich gehe nicht zu den Meetings, um das nicht zu behindern. Auf der anderen Seite sammeln die für die Aktion gerade auch Geld ein und meiner Meinung nach könnte man das an anderer Stelle besser gebrauchen. Kritisieren und reflektieren ist ziemlich wichtig. Ich persönlich versuche einen Weg zu finden, wie ich kritisieren kann, ohne den Leuten ihren Drive zu nehmen – denn der ist ja erstmal gut.
Die Begegnung mit staatlicher Repression auf Demos macht es ja erst spannend. Und genau das muss auch dem gemeinen Raver erstmal passieren. Dann kann man Themen noch einmal ganz anders angehen.
Mark Terkessidis: Die Idee mit dem selbstverwalteten Flüchtlingscamp ist ja eine super Stilblüte. Da fragt man sich wirklich, wie linke Gruppen auf die Idee kommen können, sowas zu machen. So eine Einrichtung zu organisieren ist sogar für die UNHCR teilweise ein richtiges Problem.
Friederike Krebs: Aber es gibt ja in Berlin zum Beispiel eine Gruppe von Flüchtlingen, die ein selbstverwaltetes Zentrum einrichten will. Es ist wichtig, dass nicht nur staatlich irgendwas organisiert wird. Es gibt Gruppen, die Wohn- und Lebensprojekte zusammen mit Geflüchteten umsetzen wollen.
Mark Terkessidis: Man muss unbedingt überprüfen, ob man dem überhaupt gewachsen ist, worauf man sich einlässt. Denn man hat es teilweise mit Menschen zu tun, die am Ende doch nicht so sind, wie man gedacht hat. Die sind schwierig, möglicherweise traumatisiert. Dann ziehen sie dich über den Tisch, weil sie plötzlich mit unglaublichem Reichtum konfrontiert werden. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und jetzt nach Ungarn fahren und Flüchtlinge hierherholen? Wie gesagt: Wenn die Aufmerksamkeit übermorgen vorbei ist, und in drei Monaten holen die dann keine Flüchtlinge mehr, müssen wieder die ran, die sich permanent mit dem Thema beschäftigen. Das sind dann die Leute, die seit zehn Jahren gegen Abschiebung demonstrieren, die seit zehn Jahren Flüchtlingsberatung machen. Da ist schon ein großer Gap teilweise, auch wenn ich das spontane Engagement nicht mindern möchte.
Elena Woltemade: Im Bezug auf diese Ungarn-Sache gab es auch ein Posting bei Facebook oder Twitter, das so ein bisschen viral gegangen ist. Die Empörung darüber, dass die Leute von der UNHCR in ihren Westen dort nur rumstehen und nichts machen. Ich habe dann da angerufen und gesagt: Ey, das ist vielleicht das, was du gerade beobachtest. Aber Hilfsorganisationen arbeiten ganz anders, die können ihre Leute nicht einfach hinschicken und loslegen. Da müssen Gespräche geführt und Mitarbeiter geschützt werden, es ist ein ständiges Abwägen, wo die Hilfe jetzt dringlicher ist. Da sind wir dann auch wieder bei Techno und Rave: Wenn Leute so unbedarft ihrem Herzen folgen und was reißen wollen, kann das nach hinten losgehen. Und wenn ihnen dann nicht die Dankbarkeit entgegengebracht wird, die sie erwartet haben, sagen sie ganz schnell Ciao. Das muss man echt im Blick halten, gerade bei diesem Rave-Aktionismus.
Wir reden ja über viele Gruppen, darüber, wie man sich vernetzen kann. Mark, du hast dein Buch über Kollaboration geschrieben. Wie geht das, über das wir hier reden, mit deiner Theorie einher? Auch um das Szenario einer nur kurz aufkommenden, aber nicht nachhaltigen Hilfsbereitschaft zu vermeiden?
Mark Terkessidis: Kollaboration heißt ja erstmal nur Zusammenarbeit, auch wenn der Begriff in Deutschland durch „Kollaboration mit Nazis“ eher diskreditiert ist. Die Idee der Kollaboration beruht darauf, dass es bereits Strukturen gibt, ein relativ breites Engagement bzw. einen breiten Willen zum Engagement. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass ich das alles in Selbstorganisation überführen möchte, sondern dass man im Austausch mit den bestehenden Institutionen arbeitet. Um jetzt mal ein Beispiel aus der Stadtplanung zu nennen: Die Debatte um Stuttgart 21 und den berühmten Wutbürger hat gezeigt, dass es in der Bevölkerung ein enormes Wissen darüber gibt, wie die Bahn funktioniert. Ich hab das gar nicht für möglich gehalten. Aber dieses Wissen wird in Planungsprozesse gar nicht miteinbezogen. Um das auf die Migration zu übertragen: Es gibt ein enormes Know-how in den alternativen Gruppen, im Integrationsbereich. Dieses Know-how wird in die Planungen aber oft gar nicht berücksichtigt. Wenn eine neue Flüchtlingsunterkunft geplant wird, dann spricht man gar nicht mit den Leuten, die damit ständig zu tun haben und die wissen, wie eine längerfristig funktionierende Unterkunft aussehen muss. Die wird dann einfach von irgendeinem Architekten, beauftragt von Kommune, Land oder Bund, dahin geklotzt. Nach drei Jahren stellt man dann fest, dass dieser Aufbau total sinnfrei ist. Ich würde da noch viel mehr auf den Austausch von Know-how setzen. Das geht natürlich von diesem enormen Willen zum Engagement aus. Der Neoliberalismus hat uns 25 Jahre lang Eigenverantwortung gepredigt und mittlerweile sind wir auch alle eigenverantwortlich. Wir sorgen für unsere Gesundheit und betrachten uns als kleine kapitalistische Minikrisen, müssen unsere Kinder großziehen etc. Aber wir bekommen nichts dafür. Und zwar in dem Sinne, dass wir nicht gefragt werden, wenn es um Zukunftsplanung geht. Dieser Gap wird immer größer.
Weiter ging es mit dem Frage-Antwort-Teil. Den könnt ihr hier zwar nicht nachlesen, dafür aber anhören.