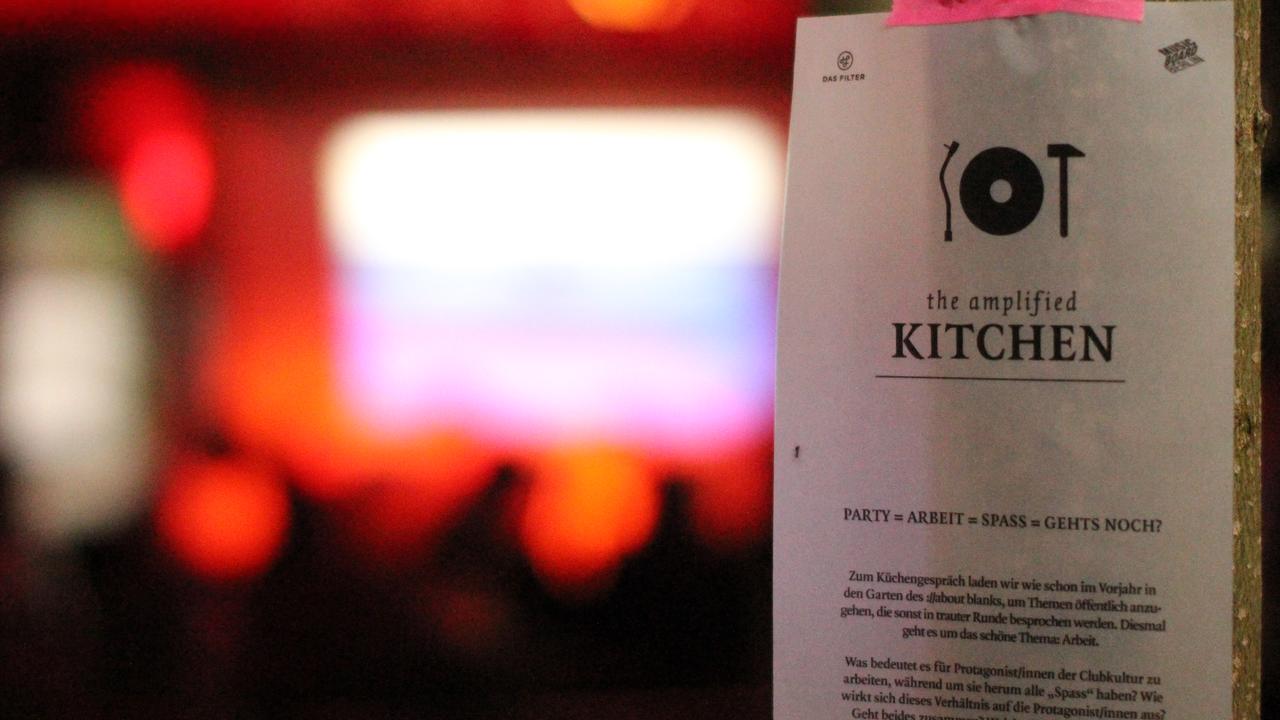Diskutieren im Grünen: „The Amplified Kitchen“, diesmal zum Thema Förderung
Die Clubkultur der Großstädte hat sich seit ihrer Sturm-und-Drang-Zeit der 1980er-Jahre grundlegend gewandelt. Heute sieht sie sich gleichermaßen mit wirtschaftlichen Vereinnahmungen, Regulierungen und Subventionen konfrontiert. In Berlin gibt es über 300 Clubs, die einen beträchtlichen Wirtschaftsfaktor für die Stadt darstellen. 170 Millionen Euro wandern dort jährlich über die Theke. Dennoch sind auch renommierte elektronische Musikfestivals wie das „Atonal“ oder das neue „Pop-Kultur“ in Berlin auf Fördermittel angewiesen. In welchem ökonomischen Verhältnis stehen Urbanität und Clubkultur, Gentrifizierung und Clubsterben zueinander? Lässt sich überhaupt noch unabhängig und unverfälscht feiern?
Ein Audiomitschnitt und eine editierte Transkription der Diskussionsrunde zum Thema Förderung in der Reihe „The Amplified Kitchen“, die im Juli im Berliner Club ://about blank stattfand.
##Die Teilnehmer
Laurens von Oswald: Leiter des Berliner Festivals „Atonal“.
Katja Lucker: Geschäftsführerin des „Musicboard“, Berlin.
Ralf Köster: Hamburger DJ-Legende und Booker im „Golden Pudel Club“.
Ralf, wie siehst du das Verhältnis von Clubkultur und Stadt als jemand, der die frühe Subkultur unmittelbar miterlebt hat?
Ralf: Ich bin in den 1980ern sozialisiert worden, da waren Hamburg und Berlin autarke, wilde Orte. Die Städte hat das alles nicht interessiert zunächst, erst ab den 1990er-Jahren haben die Städte begonnen, sich sowohl aus wirtschaftlichem Interesse als auch um kreative Eliten in die Stadt zu holen für die Clubkultur zu interessieren. Über München und Köln reden wir lieber nicht, da war es auch etwas anders. Irgendwann fing es jedenfalls an, unangenehm zu werden.
Das heißt genau?
Ralf: Ein Gentrifizierungsprozess beginnt, die Städte verdichten sich, Mieten steigen und der Gesetzgeber entwickelt eine wahre Regulierungswut, die es fast unmöglich macht, ohne staatliche Fördergeldern auszukommen.
In den 1980ern war der Staat dein Feind, von dem hat man kein Geld genommen, auf den hat man Steine geworfen.
Der „Golden Pudel Club“ ist im touristischen Hotspot des Hafens. Wenn Olympia jetzt nach Hamburg kommt, wird es auch für uns wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, ohne Fördergelder auszukommen.
Katja, was ist das Musicboard und welche Rolle spielt es für die Clubkultur?
Katja: Es gibt uns seit Januar 2013, wir sind also noch relativ frisch. Ich komme selber aus der Club- und Musikkultur und verstehe sie deshalb auch. Wir geben Steuergelder weiter, fördern Projekte, das „Atonal“, „The Amplified Kitchen“, Konzertreisen. Wir verfügen über 1,7 Millionen. Ob Veranstaltungsreihen oder Bands, wir fördern alles in Berlin. Allerdings müssen es Nachwuchskünstler sein und nicht Rammstein oder die Beatsteaks. Oft vermittle ich auch zwischen Bezirken und Clubs, das „Sisyphos“ ist so ein Beispiel. Wir bringen dann Bürokratie und Club an einen runden Tisch und plädieren dafür, dass ein bestimmter Club bleiben soll. Man kommt zu uns oder wir sprechen die Leute an.
Gibt es ein nachhaltiges Ziel für das Musicboard? Return on Investment?
Katja: Mir geht es in erster Linie um die Künstler. Geht es denen gut, geht es uns auch gut. Wir wollen, dass die Künstler für ihre Arbeit anständig bezahlt werden, setzen uns für eine Frauenquote von 50 Prozent ein, geben Künstlern Stipendien. Wie Maurice Sung von „Staatsakt“ jüngst gesagt hat, sind diese Förderungen heutzutage einfach notwendig. Das Business läuft nicht mehr wie in den 1980ern. Wir springen ein, wo Not am Mann ist, haben aber kein konkretes wirtschaftliches Ziel à la „So soll Berlin im Jahr XY musikalisch aussehen“.
Laurens, du machst das „Atonal“ seit 2013, das von der Kulturstiftung des Bundes wie vom „Musicboard“ unterstützt wird. Das ist nicht böse gemeint, aber kann man sagen, dass das „Atonal“ ein staatlich gefördertes Elektronikfestival ist?
Laurenz: Was genau ist ein Elektronikfestival? Wir haben mit Kunst zu tun, geben Nachwuchskünstlern eine Bühne, aber ja: die Musikrichtung ist elektronisch.
Anders gefragt: Könnte das „Atonal“ mit seiner künstlerischen Freiheit und seiner Kuration, ein junges Unternehmen, das internationale Aufmerksamkeit bekommt, ohne staatliche Fördergelder bestehen, zum Beispiel durch Getränkesponsoren?
Laurens: Nein, das könnte es nicht. Das haben wir sehr schnell herausgefunden. Im ersten Jahr, als wir eine geringe Fördersumme hatten, haben wir unterm Strich eine Menge verloren. Förderung ist einfach eine Riesenhilfe.

Die Diskussionsrunde: Moderator Ji-Hun Kim (Das Filter), Laurenz Oswald (Atonal Festival), Katja Lucker (Musicboard), Ralf Köster (Golden Pudel Club)
Viele Poptheoretiker sehen Populärkultur als per se durch den Kapitalismus determiniert. Was funktioniert, das funktioniert. Alles andere fällt herunter. Katja, wie siehst du das Verhältnis von nachhaltiger Förderung und Populärkultur?
Katja: Ich habe eine ganz klare Haltung. Tim Renner, unser Kulturstaatssekretär, hat 400 Millionen Etat pro Jahr, um Theater, Opern, Museen zu unterstützen. Wir rangieren mittlerweile bei 1,7 Millionen. Die Klassische Musik hat z.B. traditionell immer sehr viele Fördermittel erhalten. Wir sind dann irgendwann angetreten, um darauf hinzuweisen, dass es auch in der Popkultur förderungswerte, experimentelle Sachen gibt, die auf die Förderung darüber hinaus auch angewiesen sind. Unser großes Vorbild ist und bleibt Frankreich, Deutschland steht da noch ganz am Anfang. Auch was Stipendien angeht, gibt man die in Deutschland immer lieber an etablierte Kunstformen und eher weniger an eine junge Band wie „Isolation Berlin“ und hilft ihnen dabei, ihren Weg zu machen.
Ralf, was sagst du dazu als alter DIY-Punker?
Ralf: Das klingt erstmal toll, aber zugleich entsteht dadurch auch ein riesiger Apparat. Ich muss gerade an die Filmförderung denken, die junges deutsches Kino unterstützen sollte, heute aber all die Bully-Herbig- und Til-Schweiger-Filme finanziert. Ich habe das Gefühl, dort werden sich nur die Geschicktesten und Aggressivsten durchsetzen können. Einem achtzehnjährigen Künstler, der gerade dabei, ist seinen Weg zu finden, werdet ihr doch kein Geld geben, weil euch das Konzept nicht überzeugt.
Katja: Doch.
Ralf: Aber nochmal zu diesem wirtschaftlichen Apparat, der sich dort entwickelt. Glaubst du nicht, dass der sich irgendwann verselbstständigt?
Katja: Ja, aber dann bin ich schon weg.
Ralf: Nach mir die Sintflut also.
Katja: Ich mag es nicht, mich vereinnahmen zu lassen. Diese Gefahr besteht auf jeden Fall, aber ich versuche schlichtweg kein Stadtmarketing zu machen. Wir schlagen Abwegiges nicht per se aus und versuchen kleine Künstler und Festivals zu unterstützen.
Ralf: Aber die Gefahr dieses entstehenden Apparats siehst du schon?
Katja: Ich sehe ständig überall Gefahr. Sagen wir mal so, ich bin seit 1990 in Berlin, habe alles, was hier entstanden ist, miterlebt, habe selber Musikkram gemacht. Als Geschäftsführerin habe ich die Dinge in der Hand, aber es kann natürlich immer geschehen, dass jemand sagt: „Wenn es gerade bei euch läuft, macht doch einfach den nächsten großen wirtschaftlichen Schritt.“ Ich kann aber im Prinzip nicht sagen, was morgen geschehen wird.
In Berlin besteht dieses offensichtliche Dreieck aus Stadt, Clubkultur und Tourismus. Berlin rühmt sich ja auch ganz bewusst als Clubhauptstadt Europas. Dimitri Hegemann sagt in dem Buch „Klang der Familie“ über den „Tresor“ Anfang der 1990er: „Wir hatten ein bisschen Geld, das wir aber verballert haben. Niemand hat sich bereichert, es wurde eher verjubelt, verschenkt oder geklaut. Hätten wir den Club streng geführt, hätte der aber ganz schnell seine Seele verloren. Das wurde immer wieder in die Szene gesteckt, teilweise auch fehlinvestiert. Das geschah alles im Geiste des Ausprobieren und Erforschens“. Ist das aus heutiger Sicht naiv?
Katja: Das ist ja zum Teil immer noch der Fall in Berlin, bei all den Leuten mit ihren kleinen Clubs.
Ralf: Noch, aber das ist eine sterbende Kultur. Subkulturelle Orte, wie wir sie kannten, haben es immer schwieriger heute. Der Subventionsapparat wird das meiner Meinung nach auch nicht abpolstern können. Willst du dein Geld erst beantragen, damit du es dir klauen lassen oder es verjubeln kannst?
Laurens: Du hast auf diesem Weg sowohl Verantwortung als auch eine gewisse Freiheit.
Ralf: Aber Rock´n´Roll ist es dann nicht mehr, oder Punk, oder Jazz. Ich spreche hier von einer Lebenseinstellung. Das Problem ist die Regulierung.
Club ist Ekstase, das ist Revolution und Aufbruch. Ein Club soll mich wegkicken, wenn ich ihn betrete. Aber wenn das zu durchgeplant ist, dann haben wir es mit Eventkultur zu tun und die Leute werden sich ihren Kick woanders suchen.
Ein durchgeplantes Festival für 80 Euro kann auch schick sein, aber dieses enge, explosive Cluberlebnis wird es nicht mehr geben, wo keine Nischen dafür bleiben.
Katja: Wir müssen vielleicht unterscheiden, was einen Club ausmacht, oder ein Festival wie das „Atonal“, das durch internationale Künstler und die spezielle Location schlichtweg teuer ist. Natürlich gibt es Clubsterben in Berlin. Aber viele junge Leute, die heute hier Clubs aufmachen, sind absolut Subkultur und wollen sich überhaupt nicht regulieren lassen. Unsere Clubkommission war nie Kommerz oder Lobbyismus, wir wollen auch nicht in die Clubkultur eingreifen. Wir unterstützen Festivals wie das „Down by the River“ oder Clubs wie das „About Blank“ bei einer Reihe bloß da, wo Hilfe gebraucht wird, oder wo eine Schließung droht.

Laurens von Oswald: „Förderung ist eine Riesenhilfe.“

Katja Lucker: „Ich mache kein Stadtmarketing.“

Ralf Köster: „Es geht hier um das Recht auf Stadt.“
Dennoch ist es heute weitaus schwieriger, einen Club in Berlin aufzuziehen als früher, man denke nur an Location, Miete, Schalldämmung etc. Das sind Investitionen, die man privat kaum mehr tragen kann, auch wenn man sehr romantisch und idealistisch ist. Das Berlin oder Hamburg von heute ist nicht mehr das von vor 15 Jahren. Mir scheint das Musicboard zum Beispiel mit dem „Clubkataster“ zwar eine Kartographie der Clublandschaft zu gewährleisten oder bei Anwohnerbeschwerden wie im Prenzlauer Berg auch Schließungen zu verhindern. Trotzdem ist es für Quereinsteiger und junge Künstler schier unmöglich, heute einen fruchtbaren subkulturellen Boden zu finden und zu pflegen. Wie seht ihr diese Entwicklung?
Laurens: Ein Festival zu organisieren, ist einfach teuer. Das „Atonal“ veranstalten wir im Kraftwerk Berlin. Das ist keine Spielstätte, das ist Beton, das sind Türen und Toiletten. Durch Kartenverkauf allein kannst du das nicht finanzieren, sonst kannst du die Künstler nicht bezahlen. Trotz langer Planung und Recherche hat es immer noch eine gewisse Spontaneität. Auch wenn wir ein internationales Festival sind, bleiben wir sehr nah an den Berliner Künstlern dran.
Das hat aber auch viel mit kapitalistischem Druck zu tun, gefällt dir das, würdest du es gerne anders machen?
Laurens: Das ist einfach so.
Ralf: Ich sehe ein, in der Dimension lässt sich ein Festival vermutlich gar nicht anders auf die Beine stellen. Ich habe eher Probleme mit Industriesponsoren, beispielsweise Mercedes-Benz. Habt ihr auch welche?
Laurens: Im ersten Jahr sollten wir 1.000 Euro von Carlsberg erhalten, haben die aber nie gezahlt.
Ralf: Fick dich, Carlsberg!
Wir befinden uns in einem Dilemma. Große Industriehersteller, z.B. Red Bull oder Monster Energy, versuchen offenbar einerseits die elektronische Musikszene gewissermaßen zu vereinnahmen, andererseits gibt es Institutionen wie das „Musicboard“. Als alter Popliebhaber frage ich mal ganz naiv: „Wie wird es weitergehen?“
Ralf: Umsatzsteuerbefreiung für kleine Kulturbetriebe als GbR ist in Belgien der Hit. Eine Band oder auch kleine Clubs unter 47.000 Euro Gewinn sind steuerbefreit. Der Apparat und der bürokratische Aufwand sind dann nicht mehr so groß. Es verändert einfach eine Band, wenn sie Geld vom deutschen Staat nimmt. Für ein Mitwirken an der kommenden Olympiade haben sich in Hamburg viele Musiker ganz unkritisch der Kulturbehörde an den Hals geworfen. Dieses Geben und Nehmen war schon eine Vereinnahmung.
Katja: Wir vergeben ja nur Stipendien. Wir setzen nicht vertraglich fest, was inhaltlich gemacht werden soll. Wir prüfen die Resultate, aber nur, ob überhaupt etwas geschaffen wurde, ganz wertungsfrei. Wir erwarten noch nicht einmal, dass die Künstler unser Logo auf ihre CDs drucken, das machen die manchmal einfach ungebeten selbst. Das Clubkataster soll auch keine Partymap sein, sondern Konflikte zwischen Clublandschaft und Bebauungsplänen verhindern, sodass ein Investor einem ansässigen Club zum Beispiel Schallschutz bezahlen muss.
Kommt diese Entwicklung nicht etwas zu spät, wenn man sich den Prenzlauer Berg anschaut?
Katja: Ja, da kam sie auf jeden Fall zu spät. Hätte es uns da schon gegeben, hätte der „Knaack-Club“ nicht geschlossen. Ich habe durch alle Bezirke die Ochsentour gemacht, mit den Leuten geredet und sie auf die ansässigen Clubs aufmerksam gemacht, damit sowas wie mit dem „Knaack“ nicht mehr passieren kann. Mit dem „Sisyphos“ ist uns das ja gelungen.
Natürlich sind die Goldenen 1990er einfach vorbei, ob in Hamburg, Berlin oder Paris.
In London drohte das „Ministry of Sound“ von einem vierzigstöckigen Loftgebäude verdrängt zu werden. Die Baufirma bot in den Mietverträgen Klauseln an, die den Mieter vorwarnten, es könne etwas lauter werden. Ist das eine Lösung oder bloß Kosmetik des allgemeinen Gentrifizierungsproblems? Wie sieht das in Hamburgs Hafencity aus? Braucht es da Reglementierungen?
Ralf: Irgendwann werden einfach die Ausweichmöglichkeiten knapp. Wenn es früher Probleme mit dem Feuerwehrmann gab, der deine Heizung inspizierte, konntest du ihn mit einem ausgegebenen Schnaps auch zu der benötigten Unterschrift überzeugen. Heute kommt dir so ein adretter junger Typ in den Laden und veranschlagt erstmal Änderungen über 8.000 Euro auf 120 Quadratmetern.
Die Studien der „Night Economy“ im Bereich der Stadtforschung versuchen heute vom Taxi bis zum Eiswürfelbardienst alle ökonomischen Dienstleistungen des Nachtlebens in ihre Berechnungen mit einzubinden, um Stadtentwicklung womöglich zu regulieren, wo sie droht, eine virale Clubkultur zu unterbinden. Die Terminologie der Nachtökonomie spricht aber von einer Stadtentwicklung, die die Belange eines „attraktiven, sicheren und sozial inklusiven“ Nachtlebens mit berücksichtigt und „positive ökonomische und kulturelle Effekte“ erzielen soll. Klingt etwas unsexy, oder? Ist das der status quo, mit dem wir zu dealen haben?
Katja: Das ging doch schon mit der Blase Kreativwirtschaft los. Irgendwann hat Richard Florida diese Dinge einfach in die Welt gesetzt.
Ralf: Das alles wurde von Stadtplanern ausgenutzt. Deshalb gibt Tim Renner dir jetzt auch 1,7 Millionen.
Katja: Nein, was Tim Renner macht, ist sein Bereich, wir machen unseren. Es ist einfach der Lauf der Dinge, dass Politik oder Stadtmarketing Lobbyismus betreiben und unsexy Begriffe wie Kreativwirtschaft erfinden. „Night Economy“ klingt auch furchtbar.
Ralf: Ihr wisst aber, wie das alles endet: Alle Städte werden letztlich gleich aussehen.
Katja: Sicher, das ist eine Gefahr. Dimitri (Hegemann, d. Red.) hat ja auch immer vor der „Ballermannisierung“ der Clublandschaft gewarnt. Es ist teilweise auch einfach nicht mehr schön, was rund um das RAW-Gelände auf dem „Technostrich“ abgeht. Jetzt ist gerade der „Haubentaucher“ auf dem Prüfstein, als vermeintlicher Yuppie-Club mit Pool. Aber das ist auch normal. Jeder hat unterschiedliche Party-Bedürfnisse und Ansichten von Ekstase. Will ich auf die Show der US-Band gehen oder lieber auf ein kleines Festival? Die Party-Kultur ist sehr divers.
Ralf: Es kann aber nicht sein, dass die Leute, die in den Clubs arbeiten, sich die Stadt nicht mehr leisten können. Es geht hier um das Recht auf Stadt. Mir scheint alles auf eine Monopolisierung der Clublandschaft hinauszulaufen, die damit auch politisch kontrollierbar wird.
Katja: Ich glaube nicht, dass sich das so entwickeln wird.
Ralf: Ich finde es ja auch gut, dass das Nachtleben überhaupt mal zum öffentlichen Thema gemacht wird, aber die Bürger sollten da ihr Mitspracherecht wahrnehmen und das Feld nicht den Lobbyverbänden überlassen.

Es gibt Gegenbewegungen. In Bochum, im „Bermudadreieck“, einer klassischen Saufmeile, wird pro Kopf doppelt so viel Alkohol verkauft wie in Berlin. Dort hat der „Bebauungsplan 39“ die Zulässigkeit von Wohnen bewusst beschränkt, um den bekannten Konflikten zwischen Nachtleben und Anwohnern vorzubeugen. Dort droht das Ganze einen weiteren Turn zu nehmen und sich zur Shopping Mall zu verkehren, wo außerhalb der Geschäftszeiten gar kein Leben mehr ist.
Katja: Das ist ein Extrembeispiel. Trotzdem kann man den Menschen dort ja auch schlecht ihr Recht absprechen, im „Bermudadreieck“ Party zu machen.
Ja, zumindest wird da nörgeligen Anwohnern oder Gentrifizierern kein Platz geboten und die Stadt erkennt das Potential des Orts, genauso wie es hier in Berlin mit dem „Berghain“ oder dem „Watergate“ geschehen ist.
Katja: Da müsste man Stoffel vom „Watergate“ mal fragen, wie er das finden würde, wenn es hieße, es kommt hier jetzt keine Wohnbebauung mehr dazu. Watergate und Berghain sind ja beide jetzt nicht akut davon bedroht, weil da nicht viel ist.
Ein dystopisches Szenario: In den frühen Nullerjahren wurden Clubs ja schon uncool, wenn sie länger als acht Monate existierten. Heute feiern wir zehn Jahre Berghain. Wir fördern Clubkultur und regulieren städteplanerisch. Werden die Clubs damit nicht die neuen Theater der Stadt? Wie die Volksbühne, mit wechselnden Intendanten von der Fabric? Ralf Köster im Berghain für die nächsten drei Jahre?
Ralf: Das sind bereits die neuen Theater, schon seit Längerem. Das ist Hochkultur und das ist aufregend.
Um was für Inhalte geht es in dieser Hochkultur?
Ralf: Das würde jeder Club anders beantworten. Für mich ist ein Club Freiraum, ansonsten ist er Business. Auch das „Atonal“ ist ein Freiraum, musikalisch und für freies Denken, Leben und Ausprobieren. Und das hat Theater ja auch mal ausgemacht, heute wird da nur Repertoire gespielt, die Klassiker. Was Theater im 18. Jahrhundert war, ist heute der Club. Man könnte auch sagen: YouTube ist das heutige Theater, auch wenn da zugegeben viel Scheiß läuft.
Wird man da romantisch? Wünscht ihr euch das Berlin 1990er zurück? Was Dimitri oder Moritz von Oswald mit dem Brachland damals gemacht haben?
Laurens: Ja, man denkt: „Das war bestimmt 'ne Zeit!“: Ich bin heute 26, ich war damals vier und habe das natürlich nicht mitbekommen.
Ralf: Bist nicht reingekommen!
Laurens: Für mich ist Berlin heute aber immer noch einzigartig, es ist eine besondere Stadt. Wie Ralf sagte, es geht um Freiraum und hier kann man immer noch umsetzen, was man will. Heute zumindest noch.
Katja: Für mich, die vom Land bei Hamburg kommt, war es 1990 echt krass, durch dieses düstere Berlin zu laufen. Da war die Stadt nachts tatsächlich noch dunkel, sehr romantisch. Ich kriege da sofort eine Gänsehaut. Das war toll all das mitzuerleben, die Partys im Prenzlauer Berg, oder wie ich in der Bar neben Heiner Müller saß, der ja leider nicht mehr lebt und mich nicht traute ihn anzusprechen. Der hat tolles Theater an der Volksbühne gemacht. Aber Veränderung und Wandel sind auch Teil von Kultur und es gibt immer noch viel zu entdecken. Es findet heute noch statt, dass jemand in Berlin in einem kleinen Club großartig auflegt und es ist eben keine Eventkultur.
Wir müssen aber tatsächlich für diese Freiräume kämpfen, damals haben die Freiräume eigentlich niemanden interessiert. Heute hätte man noch viel schneller auf die rasante Entwicklung von Berlin reagieren müssen, ohne dass es gleich Stadtmarketing wird.

Um nochmal auf die Förderung zurückzukommen: Als aktiver Musiker habe ich vor ein paar Jahren oft in die Schweiz und nach Österreich rüber geschielt, wo es den sogenannten „Migros-Kulturprozent“ gibt, ein Gewinnprozent des Lebensmittelhändlers „Migros“. Mehrere Millionen wandern dort in die Kulturförderung. Das geschieht natürlich nicht ohne Bürokratie. Wenn sich das Modell „Musicboard“ etabliert, eure Hilfe und euer Engagement in Ehren, könnte der Förderantrag aber irgendwann womöglich der einzige Türöffner zu einer Musikerkarriere sein? Mit Förderung kann ich ein Jahr lang Musiker sein, danach gehe ich wieder kellnern. Das scheint mir nicht die richtige Basis für eine wachsende Kulturlandschaft zu sein.
Ralf: Oh oh oh, so einfach konnte man aber nie mit Musik Geld verdienen, da musstest du erstmal kellnern und mit deiner Band fünf Jahre über die Dörfer ziehen. Ich beneide die Achtzehnjährigen, die sich bei Katja bewerben und dann direkt Musiker werden können. Früher musstest du Geduld und Glück haben oder dich an den Teufel verkaufen. Letzten Montag ist Dieter Möbius von „Kluster“ und „Harmonia“ gestorben, der hat erst im Alter ab und an eine vernünftige Gage bekommen. Mit dem, was ich am Pudel verdiene, würde keiner von euch klarkommen ...
… wir können ja gleich Kontoauszüge vergleichen.
Ralf: Die Band ist ein Unternehmen geworden, das funktionieren muss, genauso dieser Wahnsinn der DJ-Kultur.
Laurens: Förderung beantragt man ja nicht, um davon zu leben, sondern um ein Projekt durchzuführen.
Aber wie sähe eine nachhaltigen Förderung aus? Hier scheint Kulturförderung ja immer mit einem Bildungsauftrag und wie bei Facebook mit ganz klaren Rastern und Vorgaben determiniert zu sein.
Katja: Diese Entwicklung gibt es ja überall, bei Shazam, Facebook, Google und allen möglichen Algorithmen. Das ist alles unheimlich groß, monopolistisch und man kann sich dem kaum entziehen. Viele jungen Leute sind heute anders drauf als ich damals. Ich wollte Kunst machen und habe zehntausend Jobs nebenher gemacht, vom Kellnern bis zum Bestattungsinstitut. Heute soll alles auf Knopfdruck funktionieren, die Kunst muss mein Beruf sein. Aber so funktioniert Kunst nicht. Du kannst gute Kunst machen und gut daran verdienen, aber auch eben gute Kunst machen und nichts verdienen.
Künstler sein ist immer auch ein unsteter Lebensweg. Ich weiß nicht, was David Guetta werden wollte, als er zwölf war.
Ralf: Der ist kein Mensch, sondern eine Maschine, die am Reißbrett geschaffen wurde.
Katja: Vielleicht hatte der auch mal Träume. Das „Musicboard“ ist ja direkt aus der Szene entstanden und wurde nicht von der Politik geschaffen, wir lassen den Künstlern ihre Unabhängigkeit und ihren Rock´n´Roll. Die Leute machen das so, wie sie es wollen.
Was wäre, anders gefragt, das Limit für „Musicboard“, wenn sich jeder bei euch bewerben würde, auch wenn der Topf verzehnfacht würde? Wäre das nicht dramatisch?
Katja: Gute Frage, unsere Jury hat früher von 10.000 Bewerbungen 1.000 ausgewählt. Jetzt haben wir 300 bis 400 Bewerbungen und wählen 22 aus. Es gibt natürlich auch nicht unendlich Leute, die Kunst machen wollen. Wir bewegen uns in unserem Radius ja auch in einer Blase. Und dann gibt es da noch die Anwohner, die dazu neigen, sich zu beschweren und die in der Mehrheit sind. Der Weg ist echt zu steinig, als dass Millionen Menschen Künstler sein möchten.
##Lesetipps zum Thema auf Das Filter:
„Ja, ich will die Steuergelder von Angela Merkel“ Interview mit Martin Hossbach zum neuen Festival „Pop-Kultur“
Wirtschaftsfaktor Nachtleben Gespräch mit Stadtplaner Jakob Franz Schmidt über das Forschungsprojekt „Stadtnachacht“