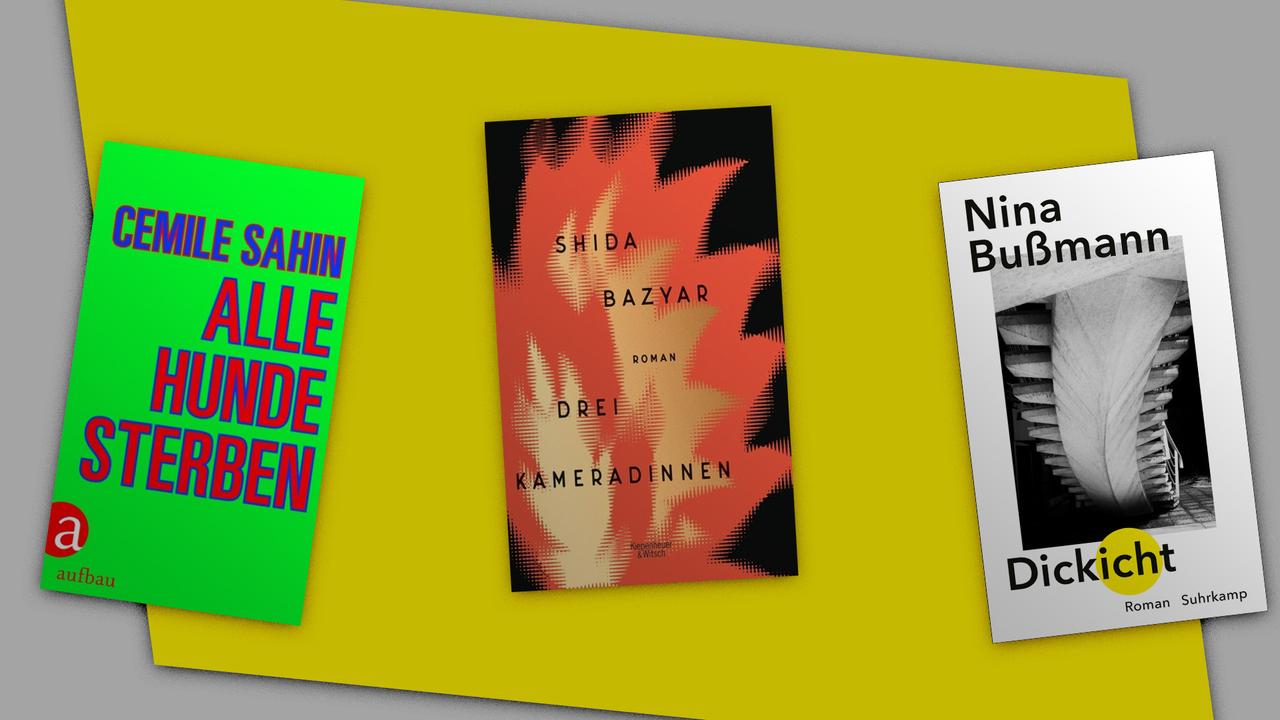„Es geht nicht um Nostalgie“Im Interview: Marie-Therese Bruglacher, Kuratorin von Disappearing Berlin
24.11.2021 • Kultur – Interview: Matti Hummelsiep
„When Doves Cry“ (2019) auf dem Dach der Schlesischen Straße 7 in Berlin-Kreuzberg. Louis Kline und Janni Struzyk. Foto: Augustin Farrias.
Nach dem Mauerfall wurde der Ostteil Berlins zum Elysium für die kreative Subkultur. In die teils geschichtsträchtigen, aber namenlosen Gebäude zogen schnell mehr oder weniger spontane Kunst- und Partyspots ein – einfach so, manchmal sogar unbemerkt. Über die DIY-Zeiten von damals kann Marie-Therese Bruglacher aus heutiger Sicht nur müde lächeln. Als künstlerischen Leiterin bespielt sie – dieses Jahr mit Anja Lindner als Projektleiterin – das zweite Jahr hintereinander verwaiste Denkmäler, ikonische Ruinen und zwischengenutzte Räume im Berliner Stadtraum. Um Nostalgie, sagt sie, geht es dabei allerdings nicht.
Disappearing Berlin rückt bestimmte urbane Räume, für die sich aus vielerlei Hinsicht niemand mehr interessiert, für ein paar Stunden ins wohlverdiente Rampenlicht: das ehemalige Postbank-Hochhaus am Halleschen Tor, das historische Baerwaldbad oder der Bierpinsel in Steglitz. Das Konzept geht auf, die Events sind regelmäßig ausgebucht. Ein Gespräch über die Idee dahinter und ob zuerst die Künstler*innen oder der Ort da ist. Außerdem: Ein besonderes Konzert auf dem Parkhaus hinter dem Zentrum Kreuzberg.
„Disappearing Berlin“ – der Name hat eine ziemlich romantische Konnotation: Worum geht es genau?
Um einen künstlerisch-performativen Ansatz, die architektonischen und gesellschaftspolitischen Momente des Wandels in Berlin in seinen verschiedensten Facetten zu erkunden. Mit Performances und musikalischen Interventionen an und in ikonischen Architekturen sowie leerstehenden und sich im Wandel befindlichen Räumen besetzen wir diese temporär – physisch mit Körpern und empirisch durch das Schaffen neuer Erfahrungen.
Das klingt sehr nach Berlin.
Die Suche und Sehnsucht nach ihrem eigenen Potential ist Berlin inhärent. Die Stadt ist zutiefst nostalgisch. Seit Generationen hängen wir zwei oder drei Jahrzehnten zurück liegenden Zuständen hinterher. Immer im Glauben, dass die Möglichkeiten damals andere waren – das ist auch ein sehr romantischer Gedanke, vor allem im Versuch, diese Vergangenheit in der Gegenwart zu beschwören. Heute sind wir in Berlin an einem Punkt, in der gerade die städtische und soziokulturelle Vergangenheit, die Freiräume und Möglichkeiten beispielsweise eines Post-Wende-Berlins, nicht mehr möglich sind. Das stellt eine Dringlichkeit dar, auf die wir seit 2019 mit „Disappearing Berlin“ reagieren. Insofern schwingt in der Serie auch etwas Romantisches mit. Es geht dabei aber nicht um Nostalgie. Wir glauben nicht, dass das Potential eines Gebäudes, wie der Bierpinsel aus den 1970er-Jahren, heute die Lösung oder sogar Erlösung von aktuellen Problemen wie unbezahlbarem und mangelndem Wohn- und Arbeitsraum ist. Vielmehr geht es darum herauszufinden, wie die eigentümlichen Bauten heute genutzt werden können und nicht als Fossilien im Stadtraum verkommen.
Wie kam es zu der Idee?
Die Idee entstand ursprünglich innerhalb des Teams im Schinkel Pavillon mit Nina Pohl, Annika Kuhlmann und mir aus dem Wunsch heraus, einen künstlerischen Umgang mit dem Wandel der Stadt zu finden. Dabei standen einerseits das schleichende und teils gleichgültige Verschwinden von ikonischen Architekturen, ebenso aber die eigentümliche Veränderung von sozialen, kulturellen und städtischen Räumen im Vordergrund. Berlin verfügt durch seine Geschichte als zerstörte, überlagerte und geteilte Stadt über wahnsinnig viele Freiräume, die nicht nur Künstler*innen und Kreativen Raum zum Experimentieren, sondern auch sehr fluktuierende Strukturen geschaffen haben.
Wie gestaltet sich die Suche nach potentiellen Spielorten?
Wir alle sind wahnsinnig viel in der Stadt rumgelaufen, geradelt, gefahren und haben erkundet. Wir machen das noch immer. Natürlich gab es Wunschorte, die wir bespielen wollten: zum Beispiel den Bierpinsel, das Quartier 206, den Mäusebunker, das Café Keese oder das ICC – das aus Kostengründen leider nie geklappt hat. Wir haben auch mit Locationscouts zusammengearbeitet. Dieses Jahr mit Iris Czak, die sich sehr genau mit spannenden Orten in dieser Stadt auskennt. Mit Anlaufen der Serie im Mai 2019 haben sich dann auch immer mehr Leute bei uns gemeldet, die Orte vorgeschlagen haben. So bildete sich ein Netzwerk aus Künstler*innen, Architekt*innen, Besucher*innen und Interessent*innen. Im Grunde sprechen wir viel mit Leuten und bewegen uns mit sehr offenen Augen durch die Stadt.

Marie-Therese Bruglacher, künstlerische Leiterin. Foto: Henry Rabe
Zur Person
Seit 2019 leitet und kuratiert Marie-Therese Bruglacher gemeinsam mit einem wechselnden Kernteam (2019-20 Franziska Zahl und 2021 Anja Lindner und Patrick Kohn) und den Kurator*innen des Schinkel Pavillon das Performance- und Musikprogramm „Disappearing Berlin“. Seit Juli 2021 läuft das Programm nun zum zweiten Mal. Ihren Master machte Marie-Therese am Londoner Goldsmiths College in Contemporary Art Theory und arbeitete vor allem zum Wechselspiel von Stadt, Architektur und sozio-kulturellen Strömungen und Bruchstellen. „Dieser Ansatz ist mir dann vor allem mit Rückkehr nach Berlin bewusster geworden. Berlin, eine Stadt, in der noch Leerstellen und Unbesetztes bestehen, in der sich Spontanes temporär formen und Einfluss haben kann.“
Die Auswahl möglicher Spielorte für eure Reihe ist in Berlin ja immer noch mehr als üppig.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz können wir nicht jeden Ort bespielen. Da kommen ganz praktische Fragen ins Spiel: Brandschutz, Sicherheit, Kapazität, Erreichbarkeit und auch unser Budget. Bei etlichen Orten haben wir schlicht eine Absage bekommen. Nicht alle Entwickler*innen oder Eigentümer*innen hat Lust auf eine kritische Auseinandersetzung. Umgekehrt wollen wir uns auch nicht vor den Karren spannen lassen, indem wir Orte potentiell aufwerten. Es bleibt also immer ein Balanceakt.
Wie wählt ihr die Künstler*innen für die jeweiligen Orte aus? Und worauf legt ihr besonderen Wert?
Zum großen Teil suchen wir die Künstler*innen zuerst aus – und besprechen dann mögliche Orte, um bestehende Arbeiten neu zu inszenieren oder neue zu entwickeln. Der Fokus der Serie liegt auf Performance und Musik, immer in Auseinandersetzung mit der Architektur oder Historie der Orte. Dabei entstehen die jeweiligen ortsspezifischen Produktionen in engem und langem Austausch mit den Künstler*innen.
Diese Arbeitsweise ist für uns alle, sowohl künstlerisch wie kuratorisch, sehr spannend, da wir oft an Offsite-Locations und jenseits institutioneller Räume agieren. Eine große Herausforderung ist dabei die Massivität, die manche Orte mitbringen. Uns interessieren Künstler*innen, die die Synergieeffekten zwischen eigener Praxis, der Umgebung und der Rezeption durch das Publikum interessiert finden. Im Bierpinsel haben wir zum ersten Mal Videoarbeiten von Manthia Diawara, Cyprien Gaillard und Cao Fei einbezogen, die räumlich die Sci-Fi-Architektur aufgegriffen haben und thematisch auf Themen wie Stadt, Veränderung, Anachronie, Beziehungen zwischen Menschen, Orten und dem Planeten eingegangen sind.

Brutalismus in Szene gesetzt: Der Berliner Bierpinsel in Steglitz während der Nutzung von Disappearing Berlin, September 2021. Foto: Dorothea Tuch, © 2021 Schinkel Pavillon
Welche Orte habt ihr nicht bespielen können?
Das alles aufzuzählen, ist frustrierend. Einige Gründe habe ich ja bereits erwähnt. Die Prozesse sind teils sehr langwierig. Da kann unser kleines Team kaum dranbleiben. Der Postbahnhof am Ostbahnhof zum Beispiel wechselte häufiger den Eigentümer, das Stadtbad Steglitz ist baufällig, im Olympiapark gibt es keine Kapazitäten und die architektonisch so schöne Dreispitzpassage in Mitte ist nicht verfügbar. Das Escados-Steakhaus am Alexanderplatz war 2019 schon verkauft, als wir dort etwas machen wollten. Ähnlich war es beim Stadion im Jahn-Sportpark, beim ehemaligen Karstadt Sport an der Kantstraße, beim LSD an der Potsdamer Straße oder bei der ehemaligen Tankstelle an der Sonnenallee. Es mangelt nicht an Orten, aber an Offenheit, diese für Kunst und Kultur zu öffnen. Andere Orte, wie das Café Keese oder auch das Wellenbad am Spreewaldplatz, sind erst mit Beginn der Pandemie offen für unsere Anfragen gewesen.

„Inner Symphonies“, ein Konzert von Hania Rani und Dobrawa Czocher im Café Keese in Charlottenburg, 8. Oktober 2021. Foto: Frank Sperling, © 2021 Schinkel Pavillon
Ein paar deiner bisherigen Highlights?
Eines meiner absoluten Highlights war das Konzert des Komponisten und Percussionisten Eli Keszler, das wir im September 2019 auf dem Dach des Parkhauses hinter dem Zentrum Kreuzberg veranstaltet haben. Steht man am Kottbusser Tor, sieht man das Parkhaus nicht, das zeitgleich mit den den Platz umrandenden Hochhausblöcken erbaut wurde. Es war der Sonntag der Art Week, Eli spielte ein einstündiges Set und hat die Kotti-Geräuschkulisse aufgegriffen. Und auch der schon erwähnte Bierpinsel liegt mir sehr am Herzen, allein weil wir so lange dafür gearbeitet haben. Im Mai 2019 haben wir die erste Anfrage gestellt, im September 2021 waren wir dann endlich vor Ort. Wir haben ein Brandschutzkonzept erstellen lassen. Ich selbst habe dafür Akten im Bauarchiv gewälzt. Wir haben sowohl den alten als auch den neuen Eigentümer immer und immer wieder „bearbeitet“, und schließlich konnten wir in Kooperation mit dem Reference Festival loslegen. Bill Kouligas und ich haben das Programm kuratiert, das den Bierpinsel auf drei Ebenen erlebbar gemacht hat. Neben den Videoarbeiten gab es ein Radioprogramm mit Asad Raza zu Édouard Glissant, eine über zwei Tage laufende Krumping Performance von Éva Mag, zwei immersive Konzerte von Amnesia Scanner, Performances von YaYa Bones, Sound von Kikommando und einen Talk mit Simon Denny und Sarah Friend. Unglaublich schön war aber auch zu sehen, welchen Ansturm es gab, wie sehr Kunst- und Architekturinteressierte, aber auch Nachbar*innen und viele Berliner*innen wieder in ihren „Pinsel“ wollten. Das waren tolle Erlebnisse. Zumal unsere Veranstaltung den Eigentümer davon überzeugt hat, das Gebäude nicht nur als Büro-, sondern auch als Kulturort zu nutzen.
Wie ist die Resonanz insgesamt?
Um ehrlich zu sein, sind wir immer wieder beeindruckt, wie groß der Andrang zu den Veranstaltungen ist, selbst wenn wir nicht im Zentrum der Stadt unterwegs sind. Disappearing Berlin hat sich als eigenständiger Satellit aus dem Schinkel Pavillon herausbewegt und funktioniert als solcher in der Stadt. Die Resonanz seitens der Künstler*innen ist immer gut, da sie sehr experimentell arbeiten können. Beim Publikum hat sich eine kleine Fangemeinde gebildet, die immer wieder durch die ortseigenen Publikumsstämme oder zufällig vorbeikommende Personen durchmischt wird.
Was ist deine persönliche Motivation, an dem Projekt mitzuwirken?
Ich bin Romantikerin, haha! Mich überzeugt vor allem die Synergie zwischen den Variablen Performance und Musik, Raum und Architektur mit dem Publikum. Wir schaffen in gewisser Weise Begegnungsräume zwischen diesen Entitäten. Das Projekt erlaubt allen beteiligten Personen viel Raum zum Experimentieren.
Was kommt als nächstes?
Am 25. und 26. November präsentiert Leila Hekmat ihre neu geschriebene Komische Oper „Il Matrimonio di Immacolata“ in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche im Hansaviertel. Die Kirche war Teil der Internationalen Bauausstellung von 1957. Der finale Event für dieses Jahr wird mit der Künstlerin Florentina Holzinger stattfinden. Leider mussten wir ihren für Anfang Oktober geplanten Performance-Parcours absagen, da sich an unserem Spielort ein Unfall ereignet hatte. Hier befinden wir uns gerade in der Stückentwicklung und Ortssuche.
Generell finde ich es spannend zu sehen, wie man über eine Plattform wie unsere Kollaborationen mit verschiedenen Institutionen anschieben kann und somit auch neue Möglichkeiten für in Berlin lebende Künstler*innen schafft.