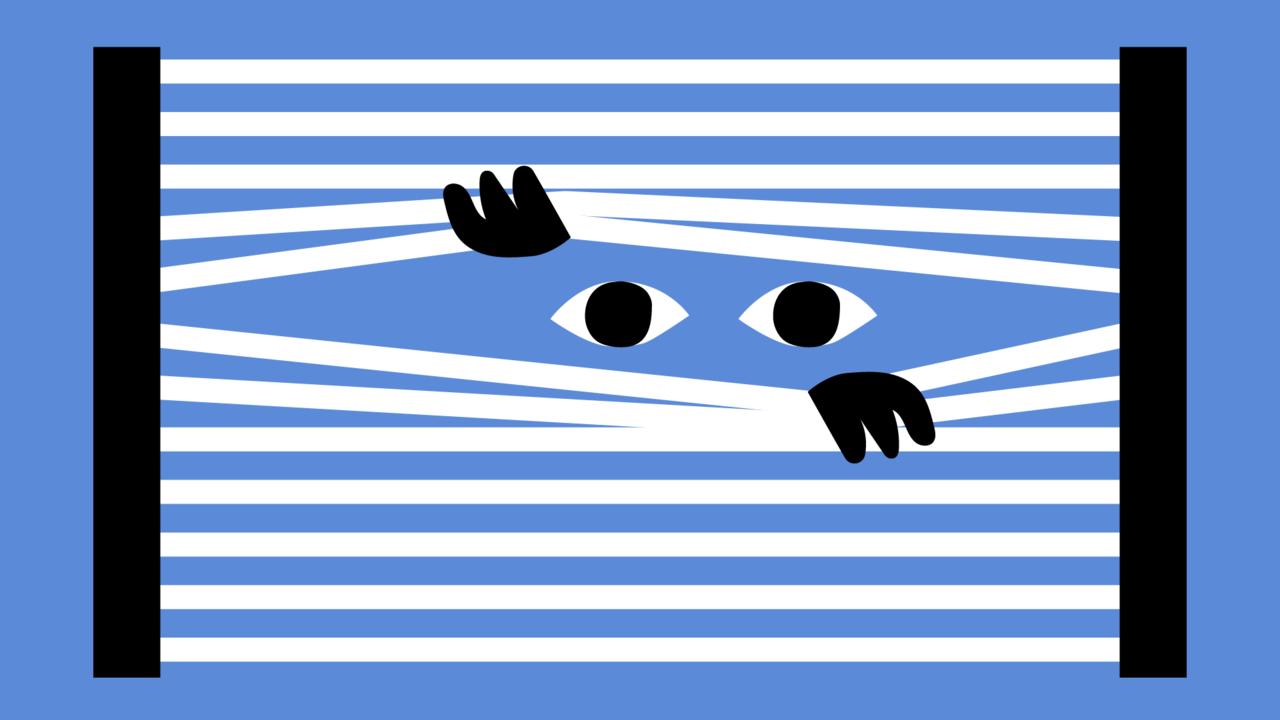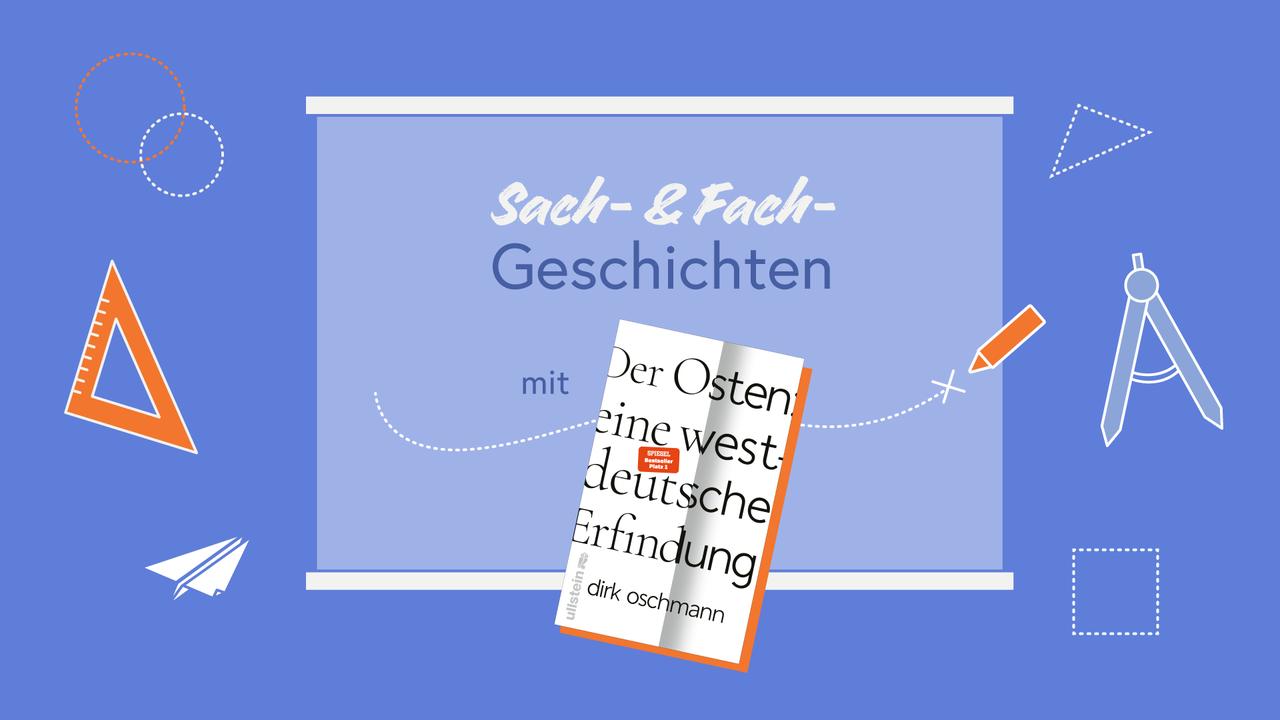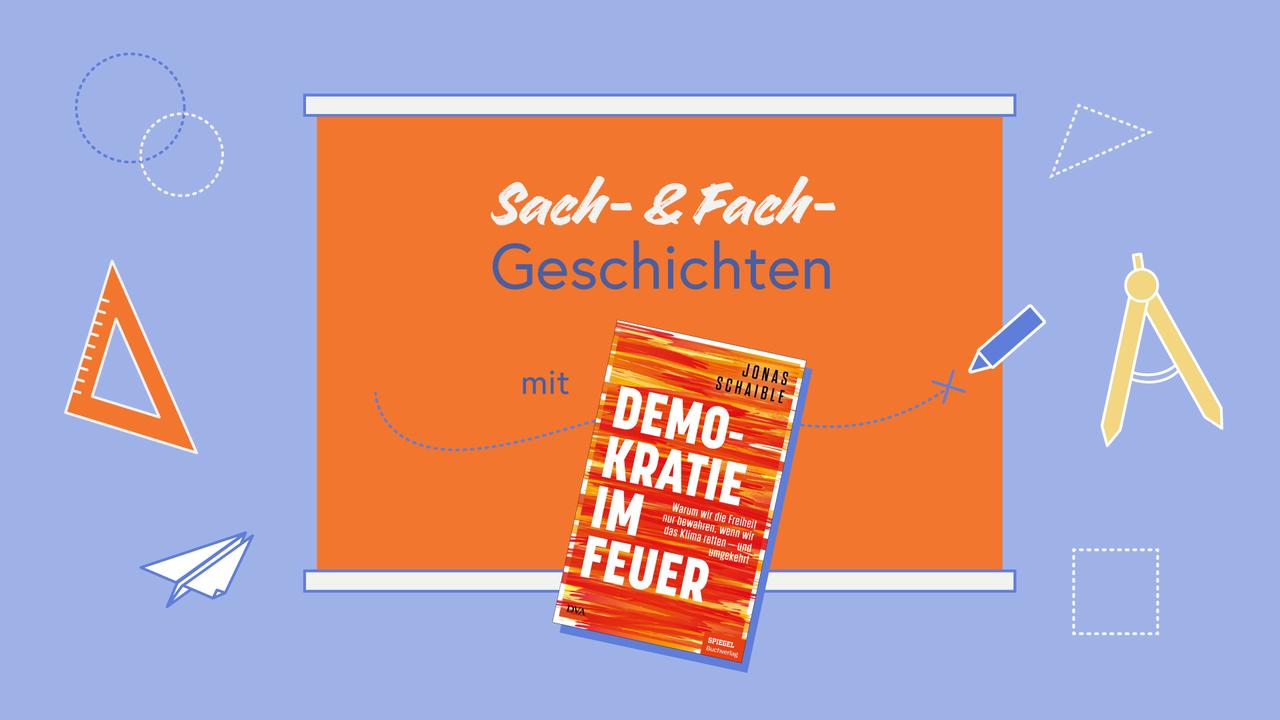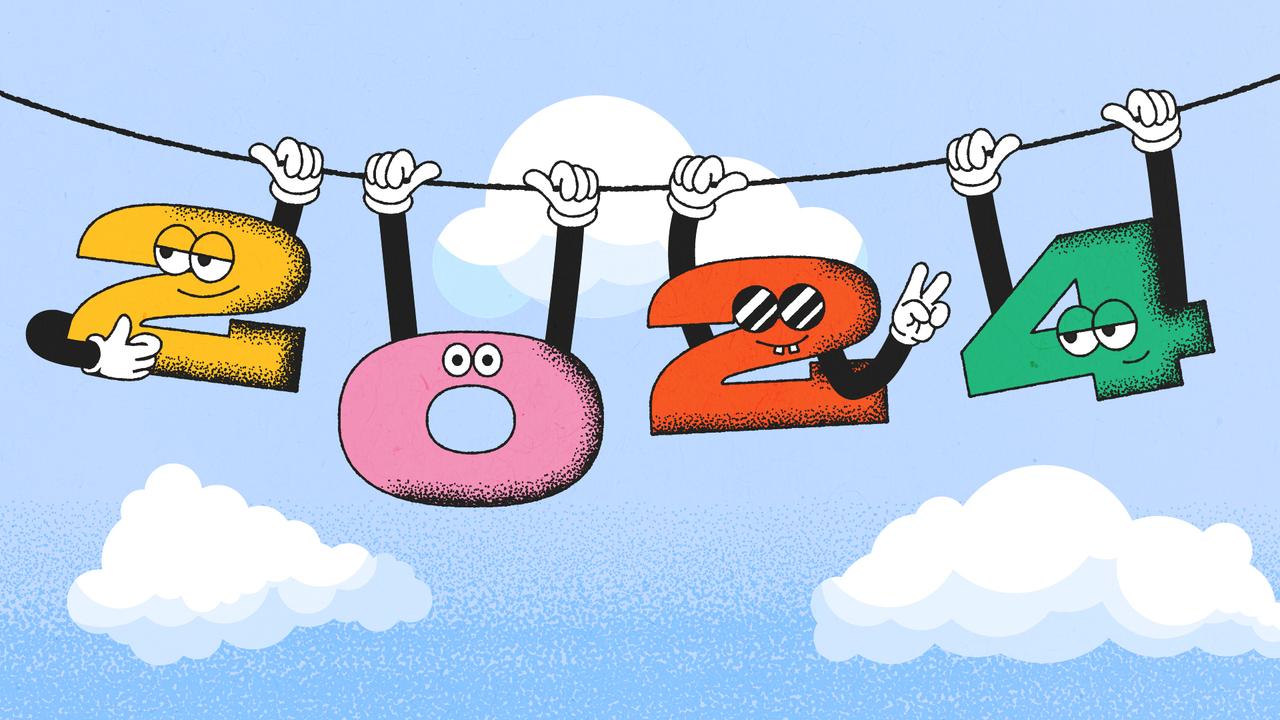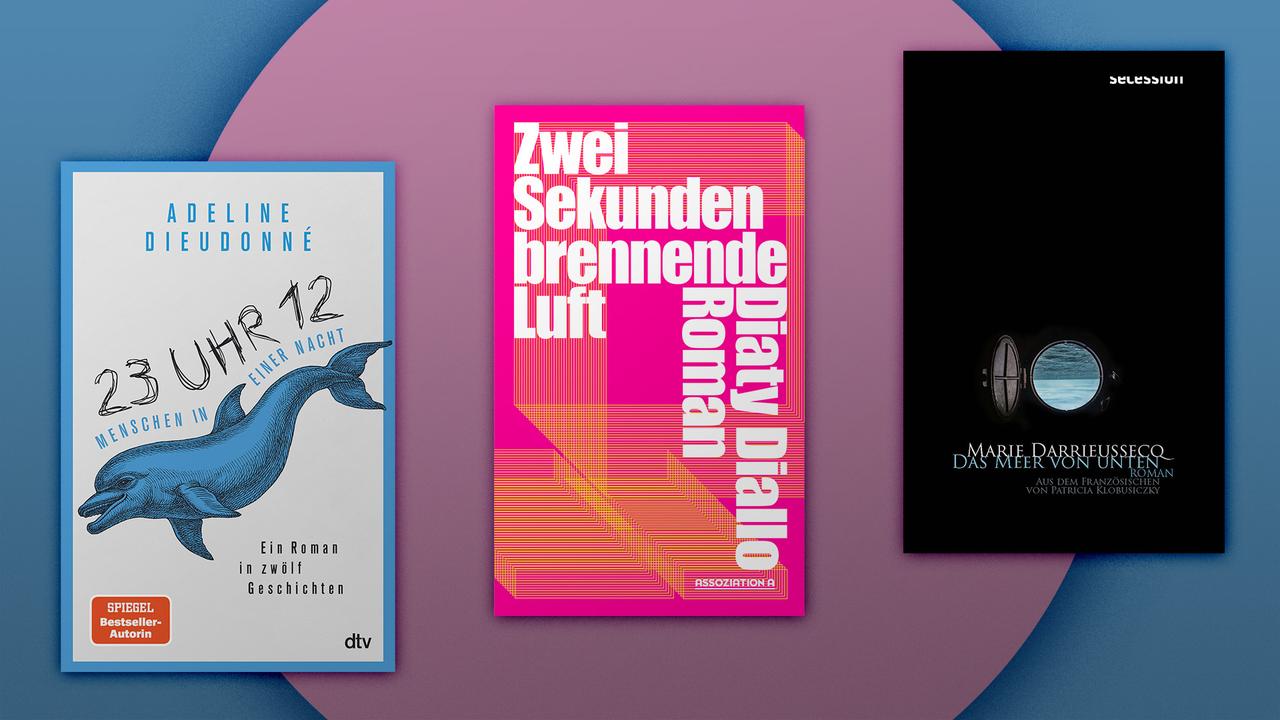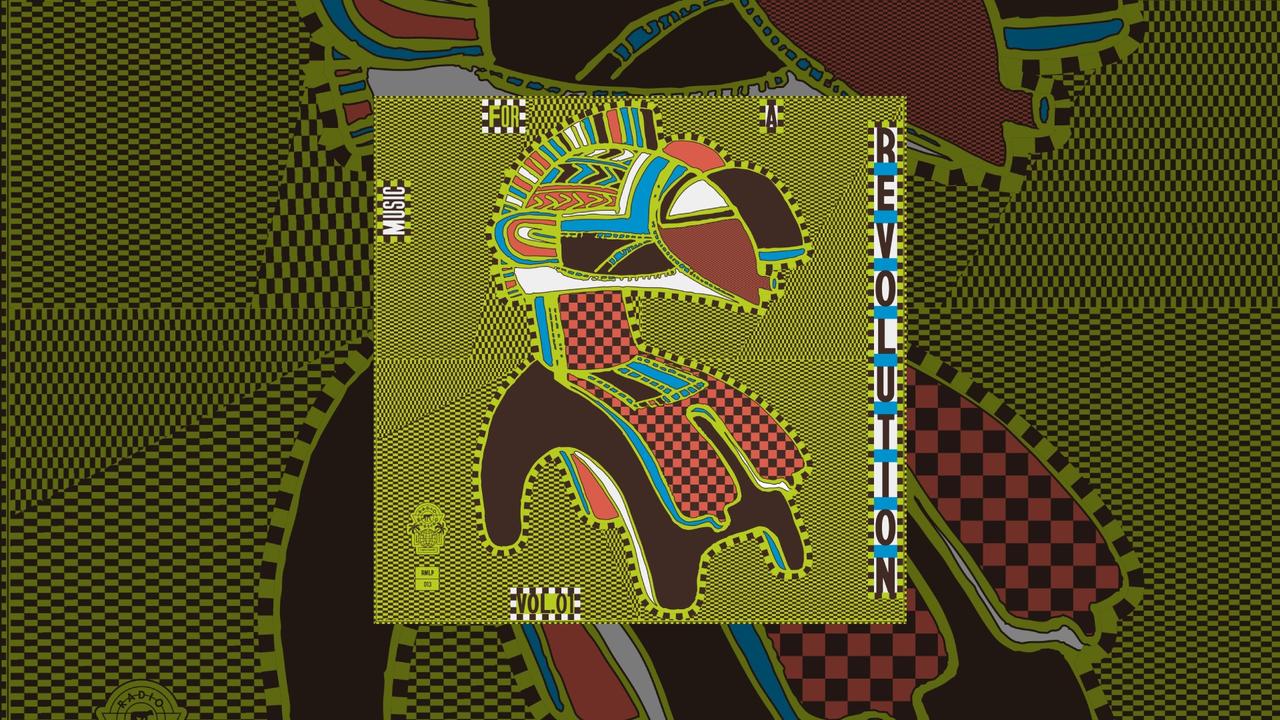Der Pandemic Turn in der biopolitischen KritikUnderstanding Digital Surveillance Capitalism | Teil 5
3.7.2025 • Gesellschaft – Text: Timo Daum, Illustration: Susann Massute
Im vierten Teil dieser Reihe ging es um toxische Privacy im Starßenverkehr. Auch in der Pandemie ist sie uns begegnet, und wir alle kennen den Typus: auf persönliche individuelle Freiheit pochen, keine Maske tragen, sich nicht die Hände waschen, sich nicht impfen lassen. Oft Männer, die ihre besten Jahre hinter sich hatten – eine Demographie wie bei Harley-Davidson-Käufern.
Die biopolitische Kritik wurde fragwürdig
In der Pandemie wurde die grundsätzliche und pauschale Skepsis gegenüber jeglicher Datensammlung insbesondere von staatlicher Seite zunehmend fragwürdig. Ist das wirklich immer zu verteufeln? Die Linke musste sich schnell entscheiden zwischen einem „weiter so“ oder einer doch generellen Zustimmung zu den staatlichen Maßnahmen. Schließlich hat sie in ihrer großen Mehrheit Letzteres getan. Schnell stellte sich ein Konsens darüber heraus, dass diese staatlichen Maßnahmen – Mobilitätseinschränkungen, Maskenpflicht, aber auch Testpflichten – bis zu einem gewissen Punkt zu begrüßen und zu unterstützen seien. Doch es dauerte lange, bis sie erstmals selbst wieder eine Position gegen bzw. in Abgrenzung zur offiziellen Politik entwickeln konnte und mit der Zero-Covid-Initiative versuchte, die offiziellen Pandemierichtlinien von links zu kritisieren.
Nur Wenige beharrten auf ihrer pauschalen Kritik jeglichen Zugriffs auf unsere Körper(daten). Einige – wie der italienische Philosoph Giorgio Agamben – waren nicht bereit, ihre von Foucault inspirierte Ablehnung jeglicher Biopolitik zu überdenken, also die Art und Weise, wie moderne Staaten die Bevölkerung durch die Steuerung von Lebensprozessen und durch Zugriff auf den Körper regieren. Und fanden sich daraufhin in einer Ecke mit Corona-Leugner:innen, Impfgegner:innen und Verschwörungstheoretiker:innen wieder, aus der sie bis heute nicht herausgekommen sind.
Die Debatte um die Corona-Warn-Apps
Die im Jahr 2020 intensiv geführte Debatte um die Corona-Warn-Apps machte ein weiteres Dilemma deutlich: Für einen Erfolg wäre ein breite Akzeptanz nötig gewesen. Eine Studie aus Oxford nannte 60 Prozent der Bevölkerung als Schwellenwert. Dieser Wert wurde bei der Corona-Warn-App sogar erreicht, bei der Luca-App jedoch deutlich verfehlt. Insbesondere diese mit 20 Millionen Euro geförderte App, deren private Betreiber:innen sie nach der Pandemie zur Bezahl-App umkonzipieren wollten, kann als Fehlschlag und Beispiel für die Verschwendung von Steuergeldern gelten. Ihr Nutzen relativierte sich dann nach der Test-, Masken- und Impfungssituation ohnehin.
Vorangegangen waren heftige Diskussionen über die Frage, ob die Daten zentral oder nur in Mobiltelefonen (dezentral) gespeichert werden sollen. Aus heutiger Sicht erscheinen diese Debatten um technische Details auch angesichts der Grundrechtseinschränkungen, die nötig wurden, als die Pandemie so richtig ausbrach, eher nebensächlich. Und als beispielhaft für eine Datenschutz-Debatte, die die gesellschaftliche Gesamtsituation aus dem Blick verliert und auf Prinzipien pocht, die wiederum (siehe dazu auch Teil 2 dieser Reihe) auf einem problematischen Verständnis von Privateigentum an Daten beruht.
Digitalkonzerne und Gesundheit – kognitive Dissonanz
Diese weit verbreitete Skepsis gegenüber Gesundheitsdatenverarbeitung durch staatliche Stellen, Praxen und Wissenschaft und Forschung stand und steht ein vergleichsweise laxer Umgang mit solchen Daten gegenüber, wenn diese von Tech-Firmen verarbeitet werden. Geht doch das überwachungskapitalistische Tagesgeschäft dieser Konzerne über Contact-Tracing weit hinaus. Die Unternehmen entdeckten vor gut einem Jahrzehnt den Bereich der Gesundheitsdaten für sich. Google erwarb 2019 den zweitgrößten US-amerikanischen Gesundheitsdienstleister Ascension und damit den Zugriff auf 50 Millionen Patient:innenakten. Apple wiederum ist Marktführer im Bereich der Wearables. In Deutschland nutzen laut Statista Digital Market Insights mehr als 18 Millionen Menschen Fitness-Apps. Apple-Chef Tim Cook schwärmte bereits 2019, „Apples größter Beitrag für die Menschheit“ werde bald im Gesundheitsbereich zu verorten sein.
Hier offenbart sich ein Paradox: Auf der einen Seite ein hohes Maß an Skepsis gegenüber staatlich-orchestrierten datenbezogenen Maßnahmen. Auf der anderen Seite die gedankenlose Akzeptanz der Datensammelpraxis privater Konzerne durch die Mehrheit der Nutzer:innen. Der Kritiker des Cyberkapitalismus David Golumbia sieht diese kognitive Dissonanz auch in der Datenschutzdebatte am Werk: „Datenschutzbefürworter konzentrieren so viel Energie auf das, was Regierungen anscheinend tun, und so wenig auf das, was Unternehmen nachweislich tun.“ Möglicherweise offenbart dieses Phänomen einen kollektiven Verdrängungsmechanismus, dem wir alle unterliegen: Haben wir einen marktlogischen Umgang mit unseren eigenen Daten soweit verinnerlicht, dass wir sie den Digitalkonzernen widerstandslos überlassen, den Gesundheitsbehörden aber die Nase vor der Tür zuschlagen?
Positive Biopolitik?
Für einen ganz anderen Blick plädiert Benjamin Bratton: Er wirft der „auf ‚biopolitischer Kritik‘ basierenden Philosophie, die jedwede auf den Körper bezogene Governance für autoritär und illegitim halten“, klägliches Versagen angesichts der Pandemie vor (Bratton 2022: 10). Während asiatische Länder – unabhängig von der konkreten Regierungsform – die besten Pandemieergebnisse erzielt hätten, regiert im Westen ein „autoritärer Anarchismus“ mit der „schlimmste(n) Kombination aus drakonischen und anarchischen Improvisationen“ (Bratton 2022: 42), begleitet durch ein „Zusammenspiel von Xenophobie und Technophobie“ und der „bewusste(n) Besetzung von Institutionen mit inkompetentem Personal“ (Bratton 2022: 43). Hierbei hat er vermutlich in erster Linie die Politik der Trump-Administration in den Vereinigten Staaten im Sinne.
Demgegenüber pocht er auf dem Recht jedes Einzelnen, „gezählt und einkalkuliert, getestet, gemessen, in Modelle überführt“ zu werden. Er sieht hingegen Datensammlungen durch eine „biopolitische Sensorschicht“, mit der wir heute Gesundheit überwachen und die „vom Fieberthermometer bis zum PCR-Testlabor reicht“ für eine Art und Weise, wie unsere Gesellschaft Wissen über sich selbst generiert und sich dadurch selbst beeinflussen kann. Diese These provoziert, steht doch grundsätzlich jedes Zählen im Verdacht, zu kategorisieren, oder wie der Soziologe Steffen Mau formuliert, jede Zählung läuft Gefahr, „qualitative Unterschiede (...) in quantitative Ungleichheiten“ zu transformieren (Steffen Mau, Das metrische Wir, Berlin 2017). Sensorik und Modellierung sind für Bratton nicht immer schon potenziell kategorisierend und diskriminierend, sondern schlicht notwendig, etwa in der Pandemiebekämpfung, aber auch Grundlage für eine „positive Biopolitik planetarischen Ausmaßes“ (Bratton 2022: 37).
Planetarer Gesundheitskommunismus
Auch Slavoj Zizek plädierte für eine globale datenbasierte Kollaboration in Menschheitsfragen wie der Pandemie. Kommunistische Maßnahmen auf globaler Ebene seien nötig, er sprach von der „Koordinierung von Produktion und Vertrieb“ im Rahmen eines globalen Gesundheitsnetzwerks. Die WHO und ihr angesichts von Anfeindungen und schwacher Mittel wirklich beachtlich vernünftiges Agieren veranlasst den Philosophen zu folgender Einschätzung: „Solche Organisationen sollten mit mehr Exekutivgewalt ausgestattet werden.“ (Zizek 2020: 41) In kaum einem Bereich macht die nationalstaatlich abgegrenzte Maßnahmen-Organisation so wenig Sinn wie bei einer Pandemie. Um in einer globalisierten Welt effektiv wirksam zu sein, sollten nicht internationale partizipativ organisierte Kollektivinstitutionen die Pandemie-Bekämpfung global organisieren, eine globale Contact-Tracing-App erstellen, ihre gesammelten Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes verwalten und ihren Einsatz orchestrieren?
Eine Parallele zum Schluss
Die Schule ist für Foucault ein Paradebeispiel einer biopolitischen Zurichtungsanstalt, die staatlich verordnete Schulpflicht ist auch so ein Zugriff des Staates auf seine Untertanen. Andererseits sind universelle und insbesondere säkulare Schulbildung unbedingt eine Errungenschaft der modernen Gesellschaft. Dies ist heute weitgehend akzeptiert, aber durchaus von konservativer bis religiös-fundamentalistischer Seite beargwöhnt. Ein ähnlicher Konflikt stellt sich beim Zugriff des Staates auf unsere verdateten Körper dar. Immer noch wird mit Unverständnis reagiert auf „ansatzlose Datensammlungen“, „lückenlose Überwachung“, „Datafizierung“ sämtlicher Lebensaspekte – aber ist das nicht die Art und Weise, wie wir heute Gesellschaft herstellen? Und das Pochen auf Datenschutz ein implizites Plädoyer für Marktlogik und die Freiheit von Dateneigentümern, mit selbigen auf dem Markt tun und lassen zu können, was sie wollen?
Um bei der Parallele zu bleiben: Sollten wir für gute Schulbildung, Ganztagsschulen und vernünftige Lerninhalte plädieren oder die Schulpflicht abschaffen, für Wahlfreiheit der Eltern und dem Einzug einer Logik von Kindern als Investitionsprojekten auf dem Bildungsmarkt?
Quellen
Benjamin Bratton: Die Realität schlägt zurück: Politik für eine postpandemische Welt. Matthes & Seitz, Berlin 2022.
Felix Maschewski, Anna Verena Nosthoff: „Überwachungskapitalistische Biopolitik: Big Tech und die Regierung der Körper“, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 32, 429–455 (2022).
David Golumbia: The Politics of Bitcoin: Software as Right-Wing Extremism, 2016
Malte Engeler: Warum wir ein Corona-Tracing-Gesetz brauchen
Slavoj Zizek: Pandemic! Covid-19 Shakes The World, 2020
Steffen Mau: Das metrische Wir: über die Quantifizierung des Sozialen. 3. Auflage, Sonderdruck, Originalausgabe. Berlin: Suhrkamp, 2018.
Timo Daum: Zwischen Plattformkapitalismus und öffentlicher Gesundheitsvorsorge: Daten-Technologien in der Corona-Epidemie