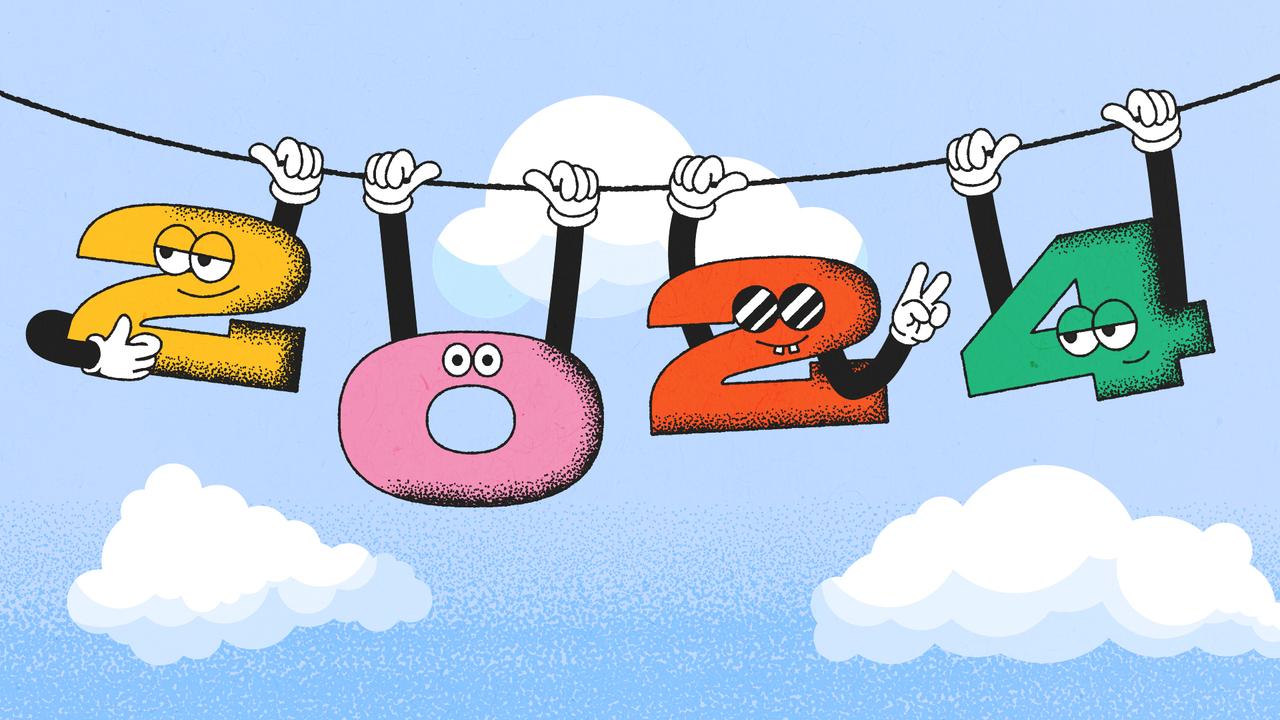Dokumentation: Was Musik mit unserem Gehirn macht„We Are One“ beleuchtet, was in unseren Köpfen geschieht, wenn wir tanzen
2.4.2025 • Film – Text: Thaddeus Herrmann
Moodyman und Kikelomo Oludemi in Detroit | Alle Fotos: (c) AlphaTheta
Der neue Dokumentarfilm von Pioneer DJ wirft einen Blick hinter das Geschehen auf dem Dancefloor – in unsere Gehirne. Wissenschaftler*innen und DJs erklären und beschreiben, was mit uns beim Tanzen passiert. Von kickenden Synapsen und flirrender Euphorie.
Wenn ein Hersteller von DJ-Equipment – noch dazu der Quasi-Monopolist Pioneer DJ – die Idee für sich entdeckt, mit Dokumentarfilmen die unterschiedlichsten Aspekte der Szene zu beleuchten, in der das Unternehmen selbst Geld verdient, kann und sollte man zunächst skeptisch sein. Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren zu viele Minuten Feel-Good-Bewegtbild großer und mächtiger Absender:innen über unsere Screens flimmern sehen mit kontinuierlichem Schulterklopfen und Autoreferenzialität. Der Dancefloor kann ein Lied davon singen.
Aber: Tatsächlich sind die Dokumentation von Pioneer DJ – AlphaTheta, wie das Unternehmen seit 2010 offiziell heißt – positiv zurückhaltend, was den brand dance angeht. Zwar sind die inhaltlichen Schwerpunkte und das Storytelling der bisherigen Dokumentationen – zum Beispiel über Ibiza – in Teilen immer mindestens diskussionswürdig, fördern aber gleichzeitig auch interessante Aspekte an die Oberfläche. Das gilt auch für den neuesten Film – „We Become One“.
Die Doku unter der Regie von Laurence Koe, der früher zum Beispiel die „MTV Party Zone“ mit Simone Angel betreut und auch für BBC, ITV und Channel 4 Filme und Dokumentationen gemacht hat, und Dan Tait nimmt ein Thema in den Fokus, über das zwar schon viel geschrieben, gesprochen, gedacht und gefilmt wurde, als zentraler Aspekt der Musik im Allgemeinen und der elektronischen Tanzmusik im Besonderen aber immer aktuell bleibt. Weil es faszinierend ist, aber auch kompliziert. Warum tanzen wir? Warum macht uns das glücklich? Warum ist das Tanzen im Club – also in der Gemeinschaft mit anderen – noch schöner und intensiver? Und was passiert da eigentlich in unseren Gehirnen, wenn Sounds und Beats analysiert und verarbeitet werden?
Um dies zu ergründen, reist DJ und Produzentin Kikelomo Oludemi um die Welt und führt Interviews. Das Lobenswerte daran ist, dass sie nicht nur mit weiteren DJs und Produzent:innen spricht, sondern auch mit Wissenschaftler:innen. Und zwar konkret mit solchen, die beim Tanzen zu Deep-House genauso viel Freude haben wie beim Schreiben eines Papers. Kikelomo nimmt die Zuschauenden mit nach Detroit auf einen Plausch mit Moodymann. In Berlin jammt sie mit KiNK, der – keine Überraschung – die Kunst der Drops und Breakdowns nicht nur beherrscht wie niemand sonst, sondern auch genau erklären kann, warum das so gut funktioniert und wie man die Crowd bei der Stange halten kann. Das ist alles toll und super, und wenn Moodymann sagt: „Alle erkennen einen guten Rhythmus. Dafür braucht es keine Vorbildung,“ hüpft das Herz direkt in die Rollerdisko downtown.

KiNK

Seth Troxler
Viel interessanter sind jedoch die Interviews und dazugehörigen Erkenntnisse der Wissenschaftler:innen, die das Gestrüpp der Synapsen entwirren und erklären, was mit uns auf dem Dancefloor tatsächlich passiert. Da ist der Neurowissenschaftler und Musiker Daniel Levitin aus Kalifornien. Er berichtet, wie und warum im Gehirn elektrische Impulse synchron zum Beat entstehen und was sie tun. Was für ein Substanzen-Mix beim Tanzen entsteht, der auf der Club-Toilette höchst illegal wäre. Und da ist Julia Basso, Neurowissenschaftlerin an der Virginia Tech, der es gelingt, den Begriff „Wir sind auf der selben Wellenlänge“ begreifbar zu machen und für das kollektive Erleben von Musik auf dem Dancefloor zu konkretisieren. Als Leiterin des „Embodied Brain Lab“ forscht sie seit Jahren an dem, was früher als brain dance bezeichnet wurde.
Diese Interviews sind die Highlights der Dokumentation, in der natürlich noch andere Aspekte thematisiert werden. Musik ist das eine, Visuals das andere: Welche verstärkende Wirkung hat das Licht im Club, der ganz eigene Rhythmus der Scheinwerfer und Effekte? Wie wird das gemeinschaftliche Sich-Verlieren so verstärkt?

Julia Basso mit Kikelomo Oludemi in ihrem Lab an der Virginia Tech
„We Become One“ funktioniert gut, wenn die Expert:innen aus ihrer Arbeit berichten, Erkenntnisse darlegen und kontextualisieren. Und weniger gut, wenn die Schnittbilder aus den Clubs zum Teil doch sehr generisch und somit austauschbar wirken. Die Tatsache, dass Techno schon seit zu vielen Jahren im Club wie Konzerte funktioniert, dass also alle den DJs „entgegentanzen“, konterkariert visuell die Berichte der Wissenschaftler:innen – und das beschworene Gefühl der Gemeinschaftlichkeit. Zudem ist die Rolle von Kikelomo Oludemi unentschieden. Mal ist sie die Journalistin, dann wieder Protagonistin und DJ. Das sind Szenen, Einstellungen und letztendlich wertvolle Minuten, die in der einstündigen Laufzeit vielleicht besser hätten verwendet werden können, hätte man sich auf eine klare Rollenverteilung für den Film geeinigt. Aber: Die intensiven und teilweise auch relativ trockenen Erläuterungen der Wissenschaft „mussten“ wohl genauso abgefedert werden.
Trotz aller Abstriche ist „We Become One“ eine klare Empfehlung. Die Einblicke in die Wissenschaft, die den Dancefloor beobachtet, sind faszinierend. Vielleicht bieten sie all jenen, die sich mit diesem Thema seit jeher auseinandersetzen, nichts Neues. Aber das ist genau das Risiko, das bei jeder Dokumentation entsteht: So konkret wie nötig, aber auch so einladend wie möglich. Die Überbrückung von Grenzen ist ja schließlich auch auf der Tanzfläche ein entscheidendes Thema – zum Glück immer noch.