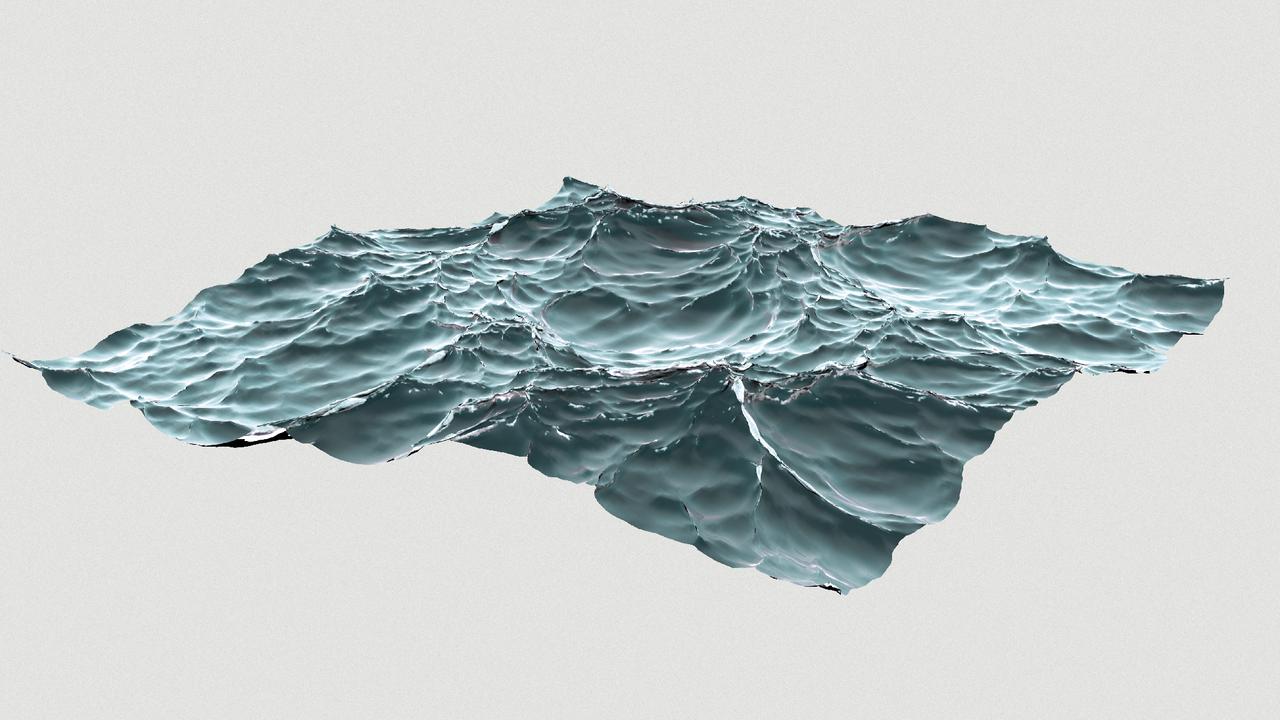Sprechen wir über die „Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes“Berlinale 2017: Regisseur Julian Radlmaier im Interview
14.2.2017 • Film – Interview: Tim Schenkl
Julian Radlmaier als Julian in Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Alle Fotos: © faktura film
„Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes“ ist Julian Radlmaiers Abschlussfilm an der Berliner Filmhochschule DFFB und einer der absoluten Kritiker-Lieblinge der 67. Berlinale. Der Film erzählt von dem Regisseur Julian, gespielt von Radlmaier selbst, der von seinem Sachbearbeiter im Jobcenter zur Lohnarbeit in einer Apfelplantage namens Oklahoma verdonnert wird. Außerdem geht es um eine ungleiche Vierer-Gruppe und deren Reise in ein kommunistisches Paradies. Tim Schenkl hat den Regisseur zum Interview getroffen.
Während in deinem letzten Film, „Ein proletarisches Wintermärchen“, eine Gruppe von Hilfsarbeitern im Mittelpunkt steht, beschäftigst du dich jetzt, zumindest dem Titel nach, mit dem Bürgertum. Einen wirklichen Paradigmenwechsel kann ich aber eigentlich nicht feststellen. Vielmehr scheint es dir wieder vor allem um das Verhältnis der Klassen zueinander zu gehen.
Stimmt, nur vielleicht mit einem neuen Fokus auf meine eigene Klassenposition. Aber natürlich handelt es sich bei der Figur Julian auch nicht wirklich um mich selbst. Sie befindet sich jedoch in einer vergleichbaren Situation und in ähnlichen Verstrickungen. Julian ist jemand, der sich auf einer ästhetischen und theoretischen Ebene mit dem Proletariat solidarisieren kann, aber in dem Moment, als er sich aus seiner Komfortzone löst, nur noch Abstiegsängste empfindet und hofft, die soziale Leiter möglichst schnell wieder nach oben zu steigen. Es geht hier also nicht nur um ein Künstlerproblem, sondern allgemeiner um die Frage: Wer muss und wer darf in der Gesellschaft eigentlich welche Tätigkeiten ausüben? Warum darf ich Filme machen und ein anderer pflückt die Äpfel für das Catering? „Proletarier“ und „Bürger“ und alles dazwischen sind ja keine essenziellen menschlichen Kategorien, sondern kontingente Klassenzugehörigkeiten. Ein „Bürger“ empfindet sein Privileg aber meist als sein angeborenes Recht, als seiner Natur entsprechend. Julian ist natürlich kein Großaktionär und doch durch sein kulturelles Kapital privilegiert. Seine Solidarität endet dort, wo dieses Privileg auf dem Spiel steht. Das war mein Ausgangspunkt. Verbunden mit der Frage: Enden Geschichten über utopische Hoffnungen vielleicht deshalb immer mit einem Scheitern, weil diese Hoffnungen insgeheim den Klasseninteressen der Erzähler widersprechen?
Julian wird in dem Film häufiger als kommunistischer Filmemacher bezeichnet. Verstehst du dich selbst auch als ein kommunistischer Regisseur?
Ich bin jemand, der in der Arbeit versucht, dem nachzuspüren, was Kommunismus eigentlich heißen könnte. Also keine Nostalgie für diesen oder jenen historischen Kommunismus, im Gegenteil. Im Grunde spüre ich eher einem ästhetischen Eindruck von Utopie nach, den ich im Kino kennengelernt habe und von dem ich glaube, dass er etwas mit einer gewissen Idee von Kommunismus zu tun hat. Manche Szenen, manche Bilder oder Figuren bei Renoir, Pasolini und Chaplin. Dazu müsste man den Begriff selbst vielleicht nicht einmal explizit verwenden. Es dann doch zu tun, erscheint mir wichtig, um klar zu machen, dass es nicht um irgendwelche vagen demokratischen Werte geht, mit denen sich jeder leicht solidarisieren kann, sondern um eine fundamentalere Kritik an der ökonomischen Ordnung und ihren Besitzverhältnissen, ihrer Verteilung von Tätigkeiten, dem Ausbeutungsverhältnis, auf dem sie gründet.
Der Begriff Kommunismus bildet also vielleicht eine Brücke von der ästhetischen Utopie zurück in die Wirklichkeit: Es gibt oder gab dort mal einen Ansatz, der vielleicht doch etwas von dem verwirklichen könnte, was wir im Kino als Glück erfahren.
Der Film gleicht in großen Teilen einer Selbstanklage und setzt sich auf kritisch-komödiantische Art und Weise mit dem Narzissmus der Kunst- und Kulturszene auseinander. Siehst du nicht die Gefahr, am Ende Applaus von der falschen Seite zu bekommen? Also von Zuschauern, die die theoretisch-intellektuelle künstlerische Praxis, egal ob in Musik, bildender Kunst oder im Film, grundsätzlich ablehnen. Ich finde, du betreibst da manchmal schon ein arge Gratwanderung und gehst außerdem teilweise schon fast zu kritisch mit „dir selbst“ um. Der Film-Julian ist ja letztlich ein absoluter Egoist. Etwas provokant gefragt: Solltest du dein eigenes Schaffen nicht ernster nehmen?
Klar kann es passieren, dass der Film missverstanden wird. Dann hätte man ihn aber falsch gelesen. Es geht ja nicht um ein simples Intellektuellen-Bashing. Und überhaupt halte ich die selbstkritische Ebene gar nicht für so zentral. Der Film argumentiert auf zwei Ebenen, einmal kritisch, einmal affirmativ, die eigentlich gleichberechtigt sind. Ein Problem ist vielleicht, dass wir den Titel von Pursuit of Happiness irgendwann in Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes geändert haben; das fanden wir ganz allgemein interessanter. An dem ursprünglichen Titel fand ich gut, dass er meine Figur nicht so in den Vordergrund stellt, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Natürlich ist meine Figur der Erzähler, es gibt aber auch wahnsinnig viele andere Figuren und es passieren viele ganz unterschiedliche Dinge. Dazu verschwindet Julian ja auch nach einer Stunde fast komplett aus dem Film. Die zweite affirmative Argumentationslinie erzählt von dem Versuch einiger Figuren, ihre Situation zu reflektieren und von dem kurzen Traum – eine Art demokratisches Ur-Moment –, ihr Leben gemeinsam selbst in die Hand zu nehmen. Ich nehme den Film und meine Arbeit am Film sehr ernst als Möglichkeit, eine kinematografische Utopie zu entwerfen.
Von Godard stammt das berühmte Diktum, dass er keine politischen Filme, sondern Filme politisch machen wolle. Dein Film wirkt oft wie die Arbeit einer Gruppe. Entspricht dies deinem Ideal von Filmarbeit?
Es ist insofern kein Kollektiv-Film, dass wir nicht alles demokratische entschieden haben, was in dem Film passiert. Trotzdem denke ich, dass Leute sich auf eine vielfältige Art und Weise einbringen konnten. Das Wichtigste für mich ist, dass alle das Gefühl haben, man macht diesen Film aus einer freundschaftlichen Verbindung heraus. Also ohne militärisch inspirierte Strukturen am Set, ohne ständig Professionalität performen zu müssen.
Ich versuche, möglichst viele Leute zu versammeln, die ich mag, die einander mögen, und die hoffentlich Spaß haben an dem, was wir machen. Was nicht übertünchen soll, dass sie dennoch schlecht bezahlt worden sind. So ganz geht der Wunsch, Filme politisch zu machen, deshalb noch nicht auf.

Deragh Campbell als Camille in Selbtkritik eines bürgerlichen Hundes
Das Ensemble, das du zusammengestellt hast, wirkt wirklich sehr bunt gemischt. Der Darsteller des Hong, Kyung-Taek Lie, ist beispielsweise der pensionierte Vater unseres gemeinsamen Freundes Sulgi Lie, der selbst auch eine Rolle hat. Viele weitere Freunde und Studienkollegen von dir haben auch als Laiendarsteller mitgewirkt. Der Volksbühnen-Schauspieler Mex Schlüpfer, einige deiner DFFB-Dozenten und der im Exil lebende georgische Dichter Zurab Rtveliashvili spielen ebenfalls mit. Julians Love-Interest Camille wird von der US-amerikanischen Indie-Schauspielerin Deragh Campbell verkörpert. Kannst du vielleicht noch etwas genauer auf den Besetzungsprozess eingehen?
Bei manchen der Darsteller war es so, dass ich extra für sie eine Rolle geschrieben habe. Andere Rollen gab es schon und dann habe ich mir überlegt, wer daraus eine interessante Figur machen würde. Dabei war für mich die Frage wichtiger, wen man in der Art und Weise interessant findet, wie er spricht und was er so macht, als die Frage, wer eine Rolle gut verkörpern kann. Ich wollte eine breite Palette von verschiedenen Stilen abbilden, die sich gegenseitig verstärken. So hat man nicht das Gefühl einer übergreifenden Ästhetik und alle spielen auf dieselbe Art und Weise glatt oder schräg, sondern ich finde es gerade gut, dass es eine Deragh gibt, die eher indie-mäßig, naturalistisch spielt, und jemanden wie Zurab, der fast schon hyper-expressiv auftritt. Ich denke, dass ein solcher breiter Fächer an Spiel- und Seinsweisen auch eine Art demokratische Utopie in Szene setzt, in der Gleichheit und Singularität zusammenkommen.
Besonders beeindruckt hat mich, dass du es schaffst, aus deinem so stark heterogenen Cast eine so homogene Gesamtperformance herauszukitzeln. Wie ist dir das gelungen, und wie war die Zusammenarbeit im Allgemeinen mit Darstellern mit so unterschiedlichen Fähigkeiten und Vorkenntnissen?
Ich habe natürlich schon geguckt, wer eigentlich was kann und wer sich vielleicht in dieser oder jener Situation unwohl fühlen würde. Jemand wie Johanna Orsini-Rosenberg, die die Apfelplantagen-Besitzerin Elfriede Gottfried spielt, kann natürlich einen Text bewusst gestalten und ist in der Lage, allein mit ihrer Sprachbeherrschung Macht auszuüben. Mit ihr haben wir dann mehr geprobt und wirklich feiner an der Diktion gearbeitet, während sich die Inszenierung bei anderen Darstellern vor allem auf das Einstudieren räumlicher Abläufe beschränkte, weil der entscheidende Teil der Textarbeit schon mit dem Schreiben und der Besetzung geleistet war. So zum Beispiel bei Kyung-Taek Lie. Dabei habe ich nicht versucht, Alltagssprache authentisch zu imitieren, sondern eine artifizielle, eher literarisch anmutende Sprache zu finden. Damit zwischen Figur und Person eine Differenz besteht, eine Begegnung stattfindet zwischen den Worten und demjenigen, der sie spricht.
Im naturalistischen Kino entsteht ja immer der Eindruck: Jemand ist ein Arbeiter, weil er eben spricht wie ein Arbeiter.
In deinen vorherigen Filmen hast du gerne wörtlich aus politischer Theorie und Literatur zitiert. In diesem Film passiert dies deutlich weniger, du verlässt dich mehr auf deine eigenen Worte. Trotzdem wirkt der Film stark literarisch beeinflusst.
Ein Gespenst geht um in Europa war ein Spiel mit referenziellen Versatzstücken, während ich in Ein proletarisches Wintermärchen bereits versucht habe, diese Art von bildungsbürgerlichen Codes stärker aus dem Film herauszunehmen und etwas zu machen, was auch unmittelbar zugänglich ist. Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes wurde in der Art des Humors, der schon sehr in der Sprache liegt, von russischer Literatur der 1920er und Autoren wie Bulgakow oder Ehrenburg beeinflusst. Auch tschechische Autoren wie Jaroslav Hašek oder auch Samuel Beckett haben mich dazu inspiriert, noch mehr mit Sprache zu spielen. Ich würde dir also zustimmen, dass die Art, wie die Dialoge geschrieben sind, mehr auf literarische als beispielsweise auf filmische Vorbilder zurückgeht.
Gab es trotzdem auch filmische Anknüpfungspunkte? Die Episode auf der Apfelplantage hat den Charakter einer Versuchsanordnung und erinnert ein wenig an Alexander Kluges „Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos“.
Natürlich entsteht so ein Film auch im Dialog mit anderen Filmen, die Ähnliches versucht haben. Am Ende des Schreibprozesses habe ich z.B. Le Crime de Monsieur Lange (1936) gesehen und war fast ein wenig erschrocken darüber: Ein zentraler Teil meines Buchs war fast ein unbewusstes Remake des Renoir-Films. Die weitere Arbeit am Film wurde dann auch wesentlich von der Auseinandersetzung mit Renoir geprägt. Die Figur des Mönchs wiederum ist sehr von Rossellini inspiriert. Pasolinis La ricotta und Große Vögel, kleine Vögel waren für mich auch wichtig, auch Straub-Huillet, auch Iosseliani, ganz heterogene Dinge. Und auch Chaplins Filme sind ja eigentlich politisches Kino – da gibt es natürlich eine große Tradition. Wir wollten aber nicht einfach nur zitieren, sondern haben eher geguckt, welche Filme bestimmte Wahrnehmungen ausgelöst haben, die etwas mit dem zu tun haben, was wir selbst machen wollten. Kluge war mit Godard und Pasolini vielleicht insofern einflussreich, dass mein Film am Ende wahrscheinlich eine Art szenischer Essay-Film geworden ist, da die Dramaturgie sehr stark aus theoretischen Überlegungen entwickelt wurde und weniger aus einer Story-Logik.
Wir haben uns überlegt, welche inhaltlichen Aspekte wir gerne im Film haben wollen, daraus hat sich eine Art Spiel entwickelt – Kurzschlüsse erzeugen, die Ideen überdehnen ins Burleske hinein. Keinesfalls wollten wir nur trocken irgendwelche Thesen abarbeiten, sondern eben doch eine Komödie machen. Im Bezug auf die Kadrage spielte – das mag jetzt überraschen – Ozu eine große Rolle. Seine Bilder haben etwas sehr Serielles, eine gewisse Gleichheit des Blicks auf die Figuren. In diesem egalitären Framing erhält gleichzeitig jeder Einzelne eine starke Präsenz. Nach den klassischen Continuity-Regeln passen seine Einstellungen oft nicht zusammen, weil zum Beispiel die Blickachsen „falsch“ sind. Und trotzdem treten sie miteinander in einen Dialog, kommunizieren gerade aus ihrer Autonomie heraus. Ein ähnliches Gefühl wollten wir auch erzeugen, ja noch verstärken, so dass der Film sehr montiert wirkt. Darin liegt eine vergessene Schönheit.
Du arbeitest in deinem Film häufig mit Einstellungen, in denen mehrere Protagonisten gleichzeitig zu sehen sind. Trotzdem hast du dich, wie in deinen vorherigen Filmen auch, für die im Gegensatz zum Breitwandformat eher beengt wirkende „Academy Ratio“ und somit für ein fast quadratisches Bildfenster entschieden. Ich habe das vor allem als eine filmhistorische Referenz verstanden. Stimmt das oder gibt es auch andere Gründe? Das Format scheint ja durch Regisseure wie Xavier Dolan gerade eine Art Revival zu erleben.
Ich finde schon, dass wir das Format sinnvoller einsetzen als einige andere Regisseure, die vor allem versuchen, einen pittoresk anmutenden Retro-Effekt zu erzielen. Im Wintermärchen haben wir es ganz bewusst gewählt, um die Gruppe der Putzkräfte mit der vertikalen Schlossarchitektur in Verbindung zu bringen. Diesmal haben wir versucht, in den Porträtaufnahmen den Gesichtern eine fast schon ikonische Präsenz zu geben und die Figur total in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe außerdem das Gefühl, dass es meiner Art der Inszenierung gut tut, im Bild durch das Academy-Format eine etwas theatralere Wirkung, einen Bühneneffekt, zu erzielen.

Szenenfoto aus Ein proletarisches Wintermärchen
Dein Film zeigt Mut zum Fantastischen, wenn zum Beispiel die Figur des Julians in einen Hund verwandelt wird. Ist die Fantasie der einzige Ausweg aus dem menschlichen Dilemma?
In einer Zeit, in der einem immer gesagt wird, die Welt sei eben so, wie sie ist und beruhe auf ewigen – psychologischen, soziologischen, ökonomischen – Gesetzen, besitzt der Film für mich die Möglichkeit, die Realität gerade nicht als etwas Gegebenes zu betrachten, sondern als eine Konstruktion. Der Film versucht, vorherrschende Sichtweisen und Ideen über diese Realität zu unterlaufen, vor allem aber kraft der Fiktion zu behaupten: Eine andere Welt ist möglich. Das ist etwas ganz anderes als eine Flucht in die Fantasie. Es geht aber natürlich auch nicht darum, eine ideale Gesellschaftsordnung im Detail zu entwerfen. Das ist nicht die Aufgabe eines Films. Vielleicht aber darum, ein Gefühl für ein, zwei Prinzipien zu vermitteln, auf denen diese Ordnung gründen sollte.