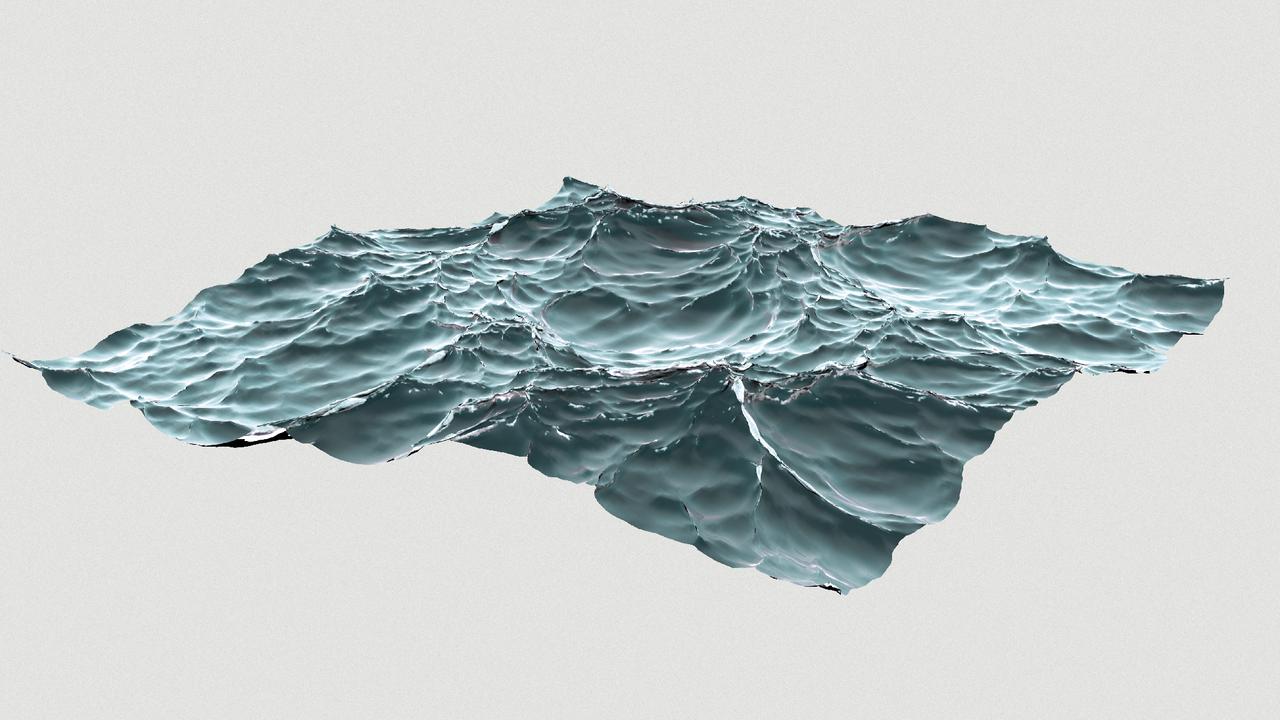„Antisemitismus ist eine Frage der Sozialisation, nicht der ethnischen Herkunft“Autor Ármin Langer im Interview über Rassismus und Miteinander
7.2.2017 • Gesellschaft – Interview: Monika Herrmann, Fotos: Thaddeus Herrmann
Ármin Langer ist 26 Jahre alt, lebt in Berlin-Neukölln und ist Jude. Der Sohn ungarischer Eltern hat in Budapest sein Philosophiestudium abgeschlossen und kam vor drei Jahren nach Berlin, um am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam jüdische Theologie zu studieren und eine Ausbildung zum Rabbiner zu machen. Beenden durfte er sie nicht, er wurde rausgeschmissen. Nicht etwa, weil er ein schlechter Student war, sondern weil er dem Zentralratsvorsitzenden der Juden, Josef Schuster, öffentlich Rassismus vorgeworfen hat. Das kam gar nicht gut an. Ármin Langer hat ein Buch geschrieben, in dem er von seinem Leben, seinem Rauswurf, seinen Kämpfen gegen Rassismus und seinen Träumen erzählt. „Ein Jude in Neukölln“ heißt es. Außerdem kümmert er sich um die Initiative Salaam-Shalom, die sich für ein gemeinschaftliches Miteinander im Kiez einsetzt. Damit respektvoller Umgang und freundschaftliches Miteinander mehr zählen, als Religionszugehörigkeit und alle Vorurteile zusammen. Monika Herrmann hat ihn zum Gespräch getroffen.
Herr Langer, als Sie vor drei Jahren nach Neukölln zogen, hat man sie gewarnt vor diesem Stadtteil. Als Jude könne man hier nicht leben. Wie erleben Sie Neukölln?
Ganz normal. Hier leben ja traditionell viele Muslime: Menschen aus türkischen und arabischen Familien. Und es ist leider auch üblich, Juden und Muslime als Erzfeinde der deutschen Bevölkerung darzustellen. Natürlich gibt es Ressentiments in jüdischen wie in muslimischen Communitys. Aber dieses Grauenvolle, vor dem ich gewarnt wurde, hat sich nicht bewahrheitet. Ich stelle immer wieder fest: Juden, Muslime und alle anderen gehen in Neukölln sehr freundschaftlich und respektvoll miteinander um. Meistens jedenfalls.
Dennoch: Es gibt – wie überall in Berlin – auch Rassismus in Neukölln. Sie haben deshalb Salaam-Shalom gegründet, eine Initiative von jungen Leuten aus der jüdischen und muslimischen Community, die sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wehrt, nicht nur in Neukölln. War es schwierig, Menschen zu finden, die gesagt haben: Ja, das ist unser Ding, da machen wir mit?
Es waren sehr schnell sehr viele Menschen dabei, die gesagt haben: Gegen Rassismus muss man etwas tun. Inzwischen ist daraus ein großes Netzwerk entstanden, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen gegen den Rassismus – nicht nur den in Neukölln – angetreten sind. Das sind jetzt 200 Leute, die mitmachen und wir sind nicht nur in Deutschland, sondern auch international aktiv.
Um was geht’s da konkret?
Wir treffen uns regelmäßig, reden über aktuelle politische Themen, beobachten die rechte Szene und deren rassistische Äußerungen und Taten. Wir bieten Gespräche an für Menschen, die an einem anderen Denken interessiert sind. Wir gehen zum Beispiel in Schulklassen oder in Neuköllner Moschee-Gemeinden und andere religiöse und weltliche Einrichtungen. Dort reden wir über Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten im Judentum und im Islam. Die Mehrheit der Schüler, die mitmachen, stammt aus muslimischen Familien. Diese Jugendlichen haben ganz oft noch nie mit einem Juden geredet. Ich merke das übrigens auch bei Lesungen oder Podiumsdiskussionen immer wieder. Ganz oft bin ich der erste Jude, den die Leute treffen. Und dort sind keineswegs nur Muslime. Salaam-Shalom lädt aber auch zum Brunch oder Konzert ein – da ist für jeden etwas dabei. Jeder kann uns kennenlernen.
Hören Sie bei all den öffentlichen Veranstaltungen auch antisemitische Äußerungen?
Natürlich. In der Schule, aber auch bei Veranstaltungen, bei Lesungen. Dann fragen mich die Leute schon mal, ob ich aus einer reichen Familie komme oder nicht. Ich denke, das ist ein Beispiel dafür, wie tief Antisemitismus in Deutschland verankert ist. Das ist problematisch – aber es ist Realität.
Die Initiative ist mit Preisen und Lobreden überhäuft worden. Der Bundespräsident hat Sie empfangen und sich für das Engagement bedankt. Hat sich denn die jüdische Community auch mal lobend geäußert?
Wir haben ja eine Kooperation mit einer jüdischen Gemeinde in Kreuzberg. Diese Synagogen-Gemeinde unterstützt unsere Arbeit, auch der Zentralrat der Juden hat uns zu einem Gespräch eingeladen. Aber gleichzeitig erfahren wir gerade von einzelnen Personen des Zentralrats immer wieder Kritik.

Was sind die Gründe?
Wir haben in der Vergangenheit Veranstaltungen mit muslimischen Gemeinden gemacht, die eine klare Pro-Erdogan-Linie vertreten und auch mit einer jüdischen Einrichtung, die die Siedlungsbauten im Westjordanland unterstützt. Dafür bekommen wir viel Kritik, aber das stört uns nicht. Denn Salaam-Shalom ist bereit, auch mit ihnen zusammenzuarbeiten und im Dialog zu bleiben. Nur wenn wir voneinander wissen und uns kennen, können wir dem Rassismus einen Riegel vorschieben. Unser Ansatz ist klar und deutlich: Wir arbeiten mit allen zusammen, die in Deutschland Opfer von Diskriminierung geworden sind. Dagegen gehen wir gemeinsam vor und zwar gewaltlos.
Als Jude sind Sie selbst auch Opfer von Diskriminierung gewesen. Allerdings von Seiten führender Köpfe der jüdischen Community. Was haben sie erlebt?
Ich würde die unfaire Behandlung nicht Diskriminierung nennen. Ich war mitten in der Ausbildung zum Rabbiner am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg, als ich dort rausgeschmissen wurde. Mir wurde vorgeworfen, ohne Genehmigung des zuständigen Pressesprechers Interviews in verschiedenen Medien gegeben und eigenständig Artikel veröffentlicht zu haben. In diesen Statements ging es um die Initiative und unseren Kampf gegen den Rassismus in Deutschland. Das passte alles gar nicht ins Bild der Leitung des Rabbinerseminars. Es folgte der Rausschmiss. Ich bin juristisch dagegen vorgegangen.
Sie haben in ihren öffentlichen Auftritten auch immer wieder den Zentralratsvorsitzenden der Juden in Deutschland kritisiert. Was haben sie ihm denn vorgeworfen?
Ich habe Josef Schuster Rassismus vorgeworfen, weil er öffentlich gesagt hat, der Antisemitismus der Geflüchteten sei ein ethnisches Problem. Er sagte auch, dass die Geflüchteten nicht fähig seien, sich zu integrieren, weil sie aus Ländern stammen, in denen Antisemitismus, aber auch Homophobie und Frauenfeindlichkeit üblich seien. Ich dagegen denke: Antisemitismus ist eine Frage der Sozialisation oder des kulturellen Hintergrunds. Also keine Frage von ethnischer Herkunft. Ich habe gesagt: Selbst wenn es so wäre, ist das kein Grund, den Geflüchteten nicht zu helfen. Und: Wenn jemand etwas anderes behauptet, tut er den Rassisten einen Gefallen. Das reichte für den Rauswurf, meine Rabbinerausbildung kann ich erstmal nicht beenden. Ich glaube aber auch, dass Neid bei der Leitung des Rabbinerseminars eine Rolle spielt. Ich bin mit 23 Jahren nach Deutschland gekommen und innerhalb von drei Jahren war ich bekannter als der Rektor des Rabbiner-Seminars, der seit 50 Jahren hier lebt.
Sie studieren aber trotzdem weiter am Abraham-Geiger-Kolleg?
Ja, das Studium der jüdischen Theologie ist getrennt von der Rabbiner-Ausbildung. Ich darf also studieren, nur nicht Rabbiner werden. Die theologische Ausbildung schließe ich dieses Jahr ab und möchte meine Ausbildung anschließend im Ausland fortsetzen. Ich bin bereits im Gespräch mit einem Rabbiner-Seminar. Das bedeutet: Ich werde Berlin erstmal verlassen, aber zurückkommen. Hoffentlich.

Sie haben in Budapest gelebt und studiert. Würde dort die Möglichkeit einer Rabbiner-Ausbildung bestehen?
Nein, jedenfalls nicht für mich, obwohl es dort ein Rabbiner-Seminar gibt. Aber die würden mich nicht nehmen, weil ich offen schwul lebe und an diesem Rabbiner-Seminar offen schwule Studenten nicht erwünscht sind. Ich wurde übrigens auch am Geiger-Kolleg in Potsdam wegen des offenen Umgangs mit meiner sexuellen Orientierung immer wieder kritisiert, aber offiziell haben sie das dort toleriert.
Im Buch beschreiben Sie ein lebendiges jüdisches Leben in Budapest. Leben Juden in Ungarn sorgloser als in Deutschland?
Nein, aber die Mehrheit der Juden aus Budapest wurde verschont und nicht deportiert. Aus diesem Grund gibt es dort heute eine sehr große jüdische Gemeinschaft, rund sieben Prozent der Bevölkerung sind jüdisch. In Berlin sind das noch nicht mal ein Prozent. Deswegen gibt es in Budapest viele Synagogen und kulturelle Einrichtungen. Es gibt ein Angebot für nicht religiöse Juden, was in Berlin gar nicht existiert, und viele jüdische Kneipen, Clubs, Cafés und Kinos.
Nehmen wir an, Sie kommen als ausgebildeter und ordinierter Rabbiner nach Berlin zurück. Welche Schwerpunkte in der Arbeit würden sie setzen?
Mein Arbeitsschwerpunkt als Rabbiner wäre der gleiche, den ich jetzt mit der Salaam-Shalom-Initiative praktiziere. Mein großer Wunsch ist, dass die Juden sich gesellschaftspolitisch mehr einbringen und sich nicht ständig nur als Opfer fühlen, sondern zusammen mit anderen ihre Stimme erheben und Rassismus – wo auch immer – bekämpfen. Wir leben ja in einer Zeit, in der dieses Engagement immer wichtiger wird.
Die Frage stellt sich doch aber, ob Sie mit ihren Vorstellungen und Wünschen eine Gemeindeleitung als Rabbiner dann übernehmen dürften. Sie würden doch wahrscheinlich sofort wieder Ärger mit dem Zentralrat bekommen, weil sie nicht auf Linie sind.
Das kann gut sein. Andererseits gibt es eine Reihe Gemeinden in Deutschland, die mich schon jetzt unterstützen. Ich habe in den letzten Jahren dort immer wieder als Vorbeter und Lehrer gearbeitet. Und es gibt ja auch viele Juden, die offen sind für meine Ideen. Es sind ganz oft nicht-religiöse oder religiös weniger observante Juden, aber mit ihnen würde ich gern eine progressive, jüdische Gemeinde hier in Berlin, vielleicht in Neukölln, aufbauen.

Ármin Langer, Ein Jude in Neukölln, 304 Seiten, ist im Aufbau-Verlag erschienen.