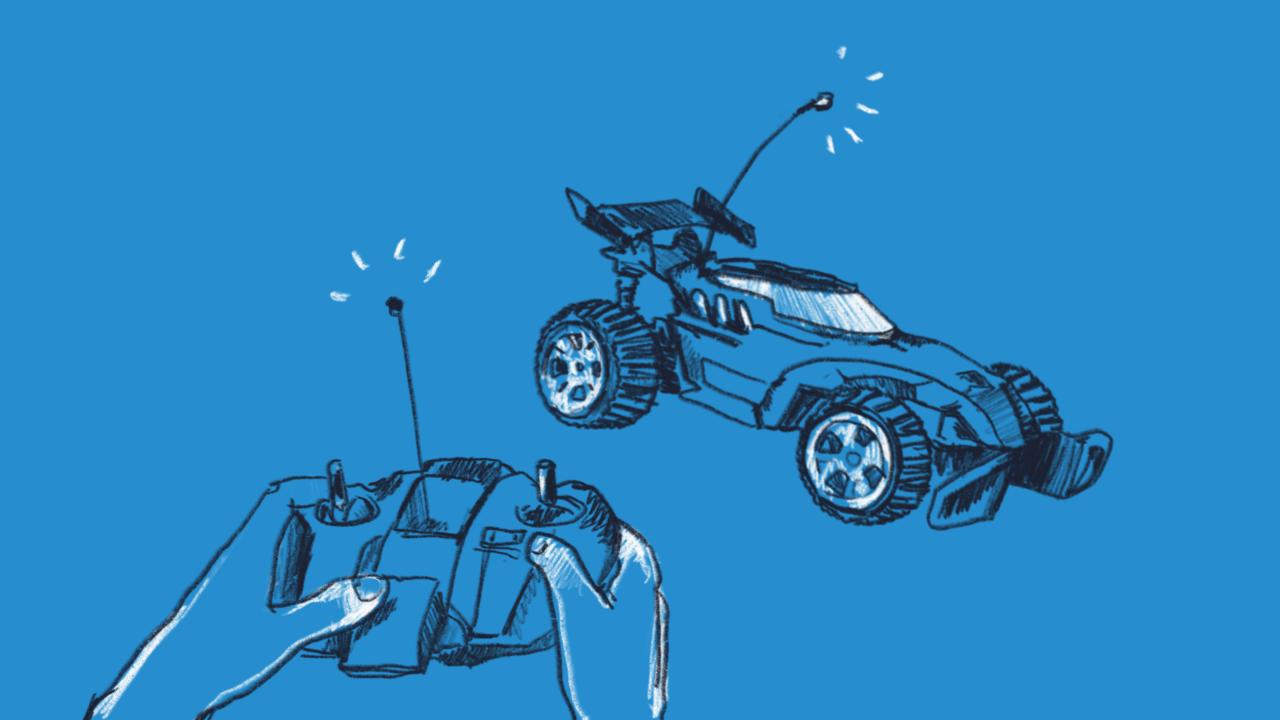Die Suche nach der Essenz des KinosSo war das Filmfestival Marseille – Teil 1
11.8.2016 • Film – Text: Henrike Meyer
Foto: Como me da la gana II © Ignacio Agüero
Das Filmfestival von Marseille (FID) gilt unter internationalen Cinephilen als Geheimtipp. Nach den ganz großen Namen sucht man im Festivalkatalog zwar vergeblich, der dokumentarische Schwerpunkt des Festivals ist jedoch einer von zahlreichen Anknüpfungspunkten, um spannende Neuentdeckungen zu machen. Aus Marseille berichtet die Berliner Filmemacherin Henrike Meyer. Heute über die Gewinner des nationalen und internationalen Wettbewerbs, sowie ein magisches Verwirrspiel aus den marokkanischen Bergen.
##Como me da la gana II
Es ist bezeichnend für das Festival, dass der Gewinner des Grand Prix Como me da la gana II von Ignacio Agüero die Suche nach der „Essenz des Kinos“ beschreibt. Dafür besucht der chilenische Regisseur junge Filmemacher bei ihrer Arbeit am Set. Direkt nach einer abgedrehten Einstellung stellt er ihnen Fragen: „Für wen machst du den Film?“ „Was ist das kinematographische Element deines Films?“ Er bekommt ganz unterschiedliche Antworten. Einer holt weit aus, spricht von den Brüdern Lumière, der Illusion und der Künstlichkeit des Kinos. Eine andere will sich mit der weiblichen Identität auseinandersetzen. Einem geht es nicht um lineare Geschichten, sondern um Atmosphären und ein hippes Regie-Duo rät ihm, dass er doch bitte lieber den Drehbuchautoren fragen soll.
Es gibt aber auch noch anderes, immer wiederkehrendes Bildmaterial: historisches Schwarz-Weiß-Footage („Was ist daran kinematographisch?“, fragt eine weibliche Stimme aus dem Off. „Die Hüte!“, antwortet Agüero); ein Homevideo (Einstellungen von Kindern, Haustieren und Vögeln vorm Fenster – draußen regnet es); dokumentarische Beobachtungen (das Meer, Menschen in Bussen, mit leeren Blicken) und immer wieder die Gesichter von Kindern im Kino.
Nach einem Drittel des Films hören wir auf einmal wieder die Stimme aus dem Off, es ist die Cutterin: „Wir haben uns verloren, Ignacio!“ Der Film fängt von vorne an.
Es geht wieder um die Frage, welche Filme während der Pinochet-Diktatur möglich waren. Wir sehen Material eines Films von 1982: Not to Forget, den Agüero unter dem Pseudonym Pedro Meneses herausbringen musste. Auch aus dem Kurzfilm Como me da la gana von 1985, bei dem sich Agüero mit der Frage beschäftigt, welche Filme man in einer Diktatur machen kann, tauchen Bilder auf. (Daher auch der Titel der Fortsetzung.)
Ein Stapel von Programmheften: Filmworkshops für Kinder. Die Filmwissenschaftlerin Alicia Vega, eine Frau mit blitzenden Augen und kindlicher Freude, hat über viele Jahre Unterricht an Schulen gegeben. Archivmaterial aus den 80ern: Sie fragt die Klasse, was für Filme sie machen wollen. „Protestfilme!“ Die Kinder zeichnen, ihre Bilder erzählen von Gewalt, Unterdrückung und Tod. Diese werden aneinander geklebt wie ein Filmstreifen.
Um ehrlich zu sein, fehlen mir einige Bezüge zum chilenischen Kino. Für Kenner ist der Film wahrscheinlich noch unterhaltsamer. Mich macht er vor allem neugierig. Gegen Ende spricht ein junger Filmemacher. Seine Worte haben mir gefallen. Auf Agüeros Frage erzählt er von dem Narrativ als Gefäß, das man mit einer Geschichte füllen kann. Dass die Begegnung beim Filmemachen für ihn essenziell ist, es geschehe immer etwas Neues, Magisches. Ein Anderer beschreibt seinen Film als nichtlinear, mit einer mosaikartigen Struktur. Es gehe nicht um Fakten, sondern um die Vielfältigkeit und Brüchigkeit der Geschichte. Agüeros arbeitet selbst mit vielen der Elemente, die im Film von den jungen Filmemachern als kinematographisch aufgezählt werden. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine Einstellung, in der die Schulkinder nach dem Workshop mit Pappkameras in die Welt ziehen. Auch ihre Eltern kommen zu Wort: Dass das Filmemachen in ihrem Kind steckte, hätten sie gar nicht gedacht!

Las Mimosas © Oliver Laxe
##Las Mimosas
Dass Oliver Laxe sich für die Magie im Kino interessiert, merkt man sofort. In seinem zweiten Langfilm Las Mimosas arbeitet er mit beeindruckenden 16-mm-Bildern – und das Schöne ist, dass sie nicht überwältigend, sondern mystisch und fesselnd wirken.
Am Anfang scheint die Handlung wie aus der Zeit gefallen: Wir sind in den Bergen, in Marokko. Da ist eine Karawane, die den Auftrag hat, einen sterbenden Scheich in die mittelalterliche Stadt Sijilmasa zu bringen, wo er begraben werden will. Der Tod ereilt ihn noch bevor sie das Atlasgebirge überqueren. Zwei der Männer, Saïd und Ahmed, erklären sich bereit, die Mission zu Ende zu bringen – ob man ihnen trauen kann, bleibt unklar.
Parallel, in einer anderen Welt, dem heutigen Marokko, gibt es Shakib, auch er bekommt eine Auftrag: Aus einer Gruppe von arbeitssuchenden Männern wird er von einem mysteriösen Anzugträger auserwählt. Der steckt ihn in ein Taxi – in einer Kolonne von Autos rauschen sie durch die Wüste – die Bilder bleiben im Gedächtnis. Shakib soll Ahmed beobachten und ihm zur Seite stehen. Er wechselt von einer Welt in die andere, von einer in die andere Geschichte und taucht plötzlich in den Bergen auf. Es beginnt eine klassische Heldenreise mit Proben und Obstakeln, die allerdings nicht nach logischem Prinzip gestrickt ist und oft rätselhaft bleibt. Stellenweise erinnert Las Mimosas an einen klassischen Western. Das Genre bietet dem Film einen Rahmen, der wiederum Freiraum für eine magische, aber auch humorvolle Erzählung gibt. In den Bildern ist eine Nähe zu den Figuren zu spüren, eine Vertrautheit mit ihren Gesichtern und Gesten. Die Darsteller sind Freunde von Laxe.
Das Ende läuft auf ein großes Finale zu, die Spannung ist hoch: Wie löst sich dieser mysteriösen Film auf, der von der „Schwebe zwischen den Dingen“ lebt?
Laxe lässt die Welten durch das Mittel der Montage immer näher aneinanderrücken und transportiert auch Ahmed auf die andere Seite des Gebirges in die Stadt. Ob es ein Flashback ist oder doch nur eine Erzählung in einer anderen (vielleicht sogar ein Traum), bleibt offen.
Am Ende kann ihnen wirklich nur noch ein Wunder helfen – aber wenn man dem angstlosen Shakib vertraut – wird alles gut. Etwas einfach aus der Affäre gezogen, könnte man meinen – allerdings ist mir dieses letzte Bild von Shakib, der sich mit Gebrüll in den Kampf wirft, stark in Erinnerung. Er ist wahrhaftig ein ganz wunderbarer Charakter, kindlich-naiv, aber gerade sein starker Glauben an das Unmögliche könnte ihm magische Kräfte geben.

Crève Cœur © Benjamin Klintoe
##Crève Cœur
Beim Gewinner des nationalen Wettbewerbes, dem Debütfilm von Benjamin Klintoe Crève Cœur, geht es auch um den/einen Glauben. Allerdings arbeitet der junge Regisseur mit anderen Mitteln und schafft ein Gefühl einer Abwesenheit, ein Fehlen von Etwas.
Am Anfang streifen zwei Männer durch den Wald. Sie rufen einen Namen: Jonathan. Niemand antwortet. Auch als sie den jungen Mann finden, bleibt dieser stumm, wortlos. Sie bringen ihn in ein Haus, wo sie ein älterer Mann empfängt. Der Junge wird gewaschen und auf eine Matratze gebettet. Sein Körper wird getragen, liegt immer wieder auf anderen Matratzen, in unterschiedlichen Räumen eines Hauses, das wir nie von Außen sehen. Er wirkt kraftlos, passiv – etwas scheint ihm abhanden gekommen zu sein, vielleicht ein Sinn für das Leben.
Die Beziehungen der Figuren untereinander bleiben rätselhaft, wie auch die Handlungen, die sie vollziehen. Da gibt es einen erleuchteten Raum im Haus – Kerzen und Marienbilder sind angesammelt. Ist es eine sektenhafte Glaubensgemeinschaft oder doch eine „normale“ Familie mit merkwürdigen Ritualen? Immer wieder werden die Figuren in fantastisches rotgrünes Licht getaucht.
Die Hausbewohner scheinen ausgegrenzt, die Welt erreicht sie nur durch Medien. Im Fernsehen laufen apokalyptische Nachrichten – und „Heidis“ heile Welt der Alpen.
Es gibt kein Entkommen aus dieser unbehaglichen Welt. Vereinzelte Ausflüge enden in dunklen, in rotes Licht getauchten Räumen: Einem Club und einer Kirche oder bei ähnlich lebenden Einsiedlern. Wenn Natur auftaucht, ist sie gezeichnet – ein Kraftwerk am Horizont, die Töne sind fahl, leblos. In die Morbidität des Films brechen aber auch zärtliche Momente ein. Tiere tauchen auf: ein Hund, Esel und Kuh im Stall (fast ein biblisches Motiv). Der Film endet nahezu kitschig mit einem Austritt einer Rollstuhlfahrerin. Die Figuren kümmern sich umeinander, sie geben sich Halt, es verbindet sie ein dünnes Band. Das ist rührend.
Klintoe arbeitet mit absurden Momenten des Alltags, einer dokumentarischen Kamera und Laiendarstellern. Durch die Inszenierung entrückt er diese reale Welt, hebt sie auf eine andere Ebene. Die Protagonisten, Figuren, die alles andere als „klassische Helden“ sind, erscheinen als Grenzgänger. Die Welt, in der sie leben, wirkt kalt und ungemütlich. Vielleicht lässt aber genau das nach einer anderen fragen.