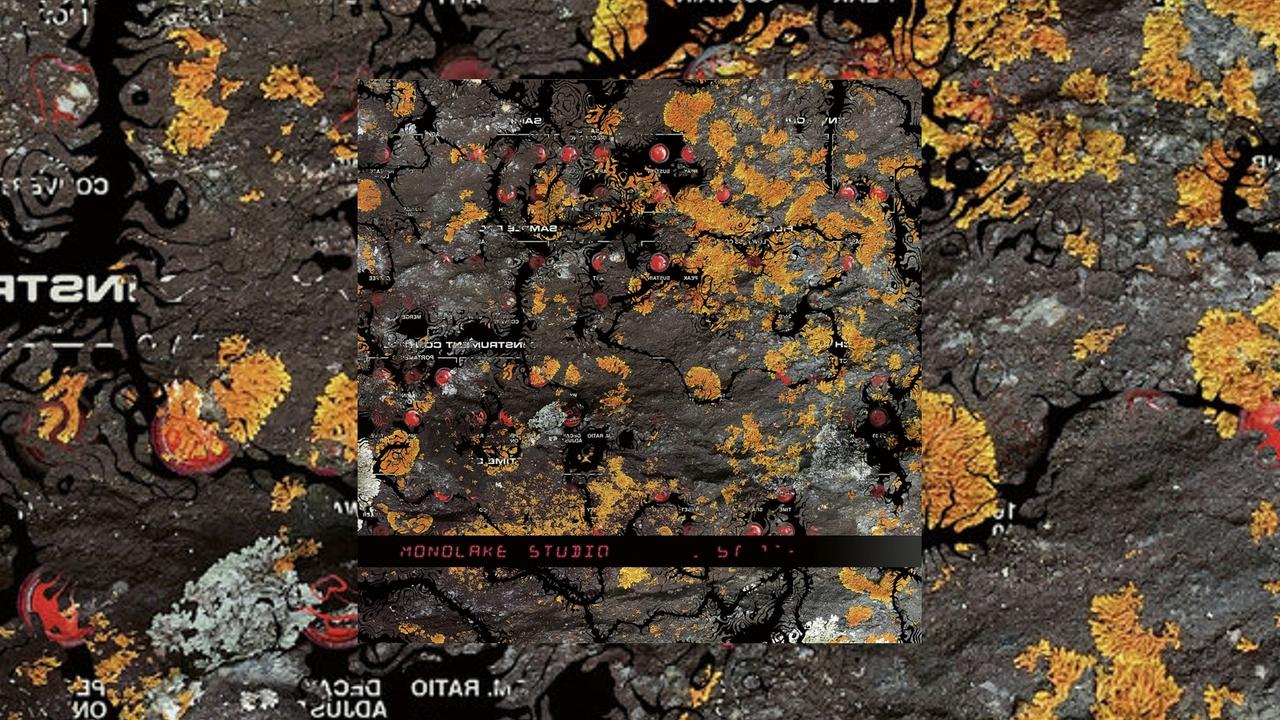Plattenkritik: Djrum – Meaning’s Edge (Houndstooth)Die Hoffnung stirbt zuletzt
29.11.2024 • Sounds – Text: Ji-Hun Kim
Hoffnung für verquaste Gemengelagen kann auch sperrig, unbequem und zugleich hoch intelligent klingen. Djrum zeigt mit seinem neuen Release, dass es ein besseres Morgen geben kann, weil es vor allem anders ist.
Gibt es in Tagen wie diesen noch den perfekten Club? Das ist gar nicht so kulturpessimistisch gefragt, wie es vielleicht klingt. Aber es sind seltsame und graue Zeiten, nicht nur in Berlin, wo Clubs wie das Watergate nach über 20 Jahren schließen müssen und viele weitere von ihrer Existenz bedroht sind, auch weil das Feierverhalten sich nach Corona stark verändert hat. Clubs wie das ://about blank beklagen, dass auch wegen der gestiegenen Eintrittspreise viele junge Raver:innen keine Getränke mehr an den Bars kaufen – was eine wesentliche Einnahmequelle darstellt –, weil sie mit zwei Pillen und Leitungswasser aus dem Klo durch die Wochenenden kommen, wovon die Clubs aber nichts haben. Durch die Berliner Groko-Sparaxt, die gerade in allen Lebensbereichen, aber vor allem in der Kultur für nett ausgedrückt miserable Stimmung sorgt, fühlt es sich für viele wieder so an wie zu Beginn von Corona. Was ist systemrelevant? Und wenn ja, wieso? Warum werden schon wieder Parteien gegeneinander ausgespielt? Kitas gegen Clubs, Kultur gegen Schwimmbäder und so weiter. Joe Chialo posaunte vor zweieinhalb Wochen noch bei einer Rede, dass die Kultur die „Schwerindustrie Berlins“ sei. Das ist aus heutiger Sicht doppelt und dreifach zynisch. Weil sind nicht Volkswagen, Bergbau, Bosch und Thyssen deutsche Schwerindustrie? Branchen, die mit Milliardensubventionen seit vielen Jahren am Leben gehalten werden, um letztlich doch den Bach runterzugehen und viele Tausende Angestellte mitreißt?
Auch die Musik auf den Dancefloors wirkt durch immer dominanter werdende TikTok-Hypes und Retro-Kitschpop-Baller-Mashups merkwürdig entrückt. Man kann und muss sich von der Legacy, der Geschichte emanzipieren, aber es braucht dennoch ein Bewusstsein darüber, was das Fundament der ganzen Angelegenheit ist, und das, so meinen viele DJs, sei im Feiermainstream auch immer mehr zur Nebensache geworden.
Auch ich, das hat natürlich viele andere Gründe, sehe Clubs so gut wie gar nicht mehr von innen. Neulich traf ich in Neukölln einen der ehemaligen Betreiber des Farbfernsehers. Wir schauten uns beide an und fragten uns natürlich, ob es an uns und unserem Alter lag, dass wir nicht mehr dabei sind, oder ob es vielleicht doch mal andere Zeiten gab, die mehr durch lokale Szenen geprägt waren, durch reale Netzwerke, weil man noch eigene Vinyl-Promos mit dem Fahrrad befreundeten DJs vorbei brachte und jedes Wochenende die Chance war, etwas neues Glanzvolles zu erleben und nicht mit der Sorge zu leben, sich die schönen Erinnerungen durch ein halbgares Reenactment madig zu machen, was wiederum eine rhetorische Frage ist. Aber DJ- und Clubkultur bleibt eine Musikkultur und die schönsten Geschichten bleiben die, wenn man ganz klein und unten anfängt und sich peu a peu nach oben spielt und dabei nicht vergisst, wo man herkommt. Wenn es aber die kleinen Clubs kaum mehr gibt, was bereits der Fall ist, dann können wir auch Reality-TV mit CDJs angucken, was vielleicht sogar spannender ist, weil da wenigstens jeder weiß, dass es nicht um Authentizität und Qualität sondern um Entertainment und Quoten geht.
Fünf Jahre sind seit dem letzten Release von Felix Manuel als Djrum vergangen. Damals noch auf R&S, und ich erinnere mich an Zeiten Anfang der Zehner, in denen gefühlt alle zwei Wochen was Neues von ihm erschien. Der Londoner stand schon immer für das Ausloten von Grenzbereichen. UK Bass, House, Techno, Dubstep, Elektronik. Eklektisch war es aber nie, eher eine Pastiche, ein respektvolles Verweben diverser Welten und Einflüsse und ohne genau zu wissen, was Djrum die letzten Jahr produktionstechnisch gemacht hat (dieses Jahr erschien auf Ilian Tape seine 12-Inch „Basis“) ist „Meaning’s End“ in vielerlei Hinsicht besonders und eigen- wie einzigartig. Felix Manuel war in den letzten Jahren viel unterwegs. Spielte in Glastonbury und machte gemeinsame Sache mit dem London Contemporary Orchestra, was unsereins instinktiv in Defensivposition bringt. Aber dieser lang erwartete, beziehungsweise überraschende, Release ist ein spannender und versöhnlicher Entwurf, weil es durch und durch Dancefloor ist, aber anders und teils innovativ gespielt. Besonders die von Djrum selbst gespielten Flöten sind ein Dreh- und Angelpunkt. Bei Flöten im Rave denke ich an „Voodoo People“ von The Prodigy, das hier ist aber eher André 3000.
Sie atmen jazzig, wenn auch klug sequenziert und digital arrangiert. Bansuri, Shakuhatchi und Querflöte werden teils unkenntlich zu einem eigenen Sound gemischt. Perkussive Referenzen wie klassische UK-Breakbeats oder Deep-House-Congas spielen eher melodiöse Rollen, als nur gesampeltes Material für einen Loop zu sein. Mich faszinieren die filigran ausproduzierten Ride-Becken, die im Headroom fliegen wie Schwalben zum Frühsommer und etwas angenehm Warmes schaffen, und es ist alles frisch und intelligent arrangiert, ohne aber sich dem Plastic People zu verweigern. Man könnte die EP mit ein bisschen über 30 Minuten Spiellänge als eine Art Abrechnung verstehen. Eine Abrechnung, die keine verbitterte oder sarkastische ist. Ich lese das eher so, dass selbst in Zeiten, in denen vielleicht vieles unwiderruflich verloren gegangen ist, nur noch die Musik selber Hoffnung schenken kann. Weil sie sich neu erfinden kann, ohne sich an festgefahrene Strukturen klammern zu müssen. Dass Themen wie Musikethnologie, Beat Science und Jazz ohne Frage im Club stattfinden können, wenn man nur weiß, wie man sie musikalisch zum Ausdruck bringt, ohne oberlehrerhafte Hülse zu sein sondern auch einfach zeitloser künstlerischer Ausdruck, weil man es anders vielleicht gar nicht kann. Man möchte hier kein Meisterwerk ausrufen, nur damit man „Meisterwerk“ gesagt hat. Aber während an meine Fensterscheibe schmeißfliegengroße Regentropfen klatschen und Optimismus unter den Dielen gesucht werden muss, schafft diese Platte im richtigen Moment in meinem Kopf und Bauch Räume, die nicht unbedingt wie Softeis im Phantasialand schmecken, sondern sperrig sind, unbequem an den Tellerrändern der Reminiszenzen balancieren und Fragen aufwerfen, wie wir weitermachen. Irgendwie geht es weiter, es braucht vor allem aber den Glauben an intelligente und gute Musik.