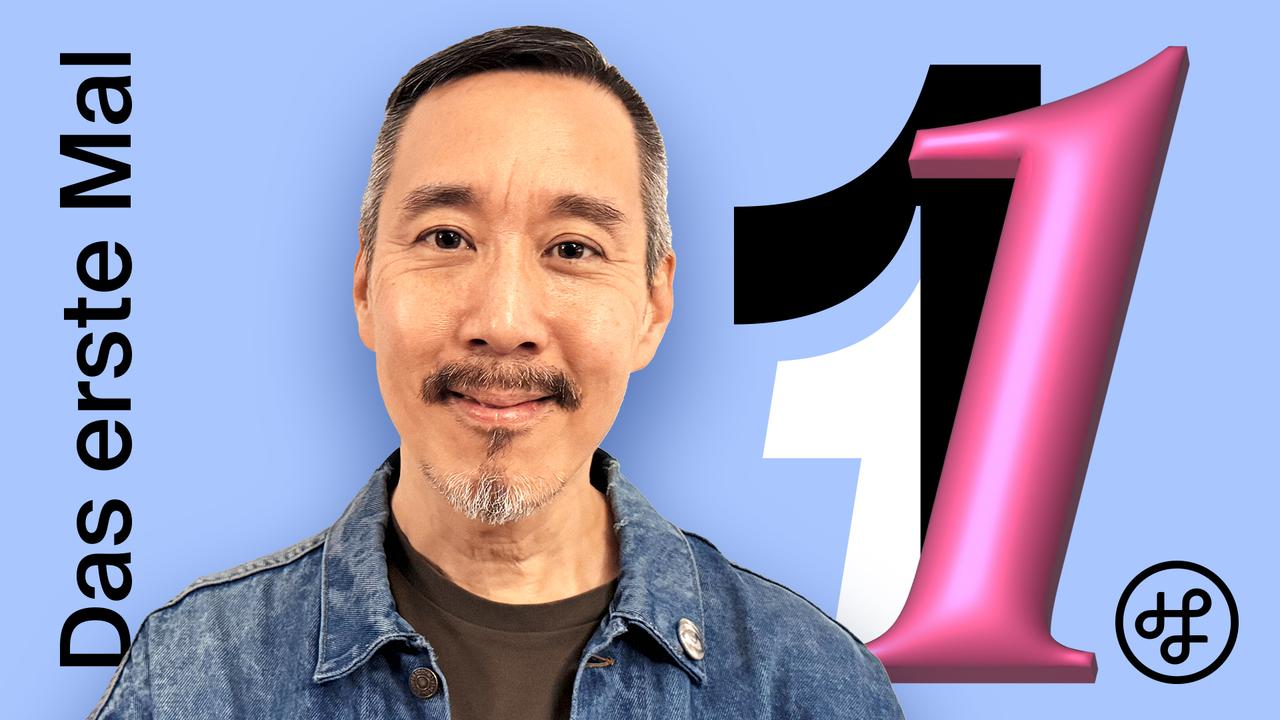Pageturner – Dezember 2024: FamiliäresLiteratur von Yasmina Reza, Irina Kilimnik und Femke Vindevogel
4.12.2024 • Kultur – Text: Frank Eckert, Montage: Susann Massute
In Yasmina Rezas „Serge“ reist eine jüdische Großfamilie nach Auschwitz, um wieder zueinander zu finden. In Irina Kilimniks „Sommer in Odessa“ ist 2014 der Krieg zwar schon da, die Probleme sind aber andere. Und in Femke Vindelvogels „Backstein“ spürt die Erzählerin der DDR-Nostalgie ihres gewalttätigen Vaters nach – in einem Ostberlin, das sich radikal verändert. Drei ganz unterschiedliche Blicke auf drei ganz unterschiedliche Familien.

Serge (Affiliate-Link)
Yasmina Reza – Serge (Carl Hanser, 2022)
Es ist die Ehre des Artisten, Schweres leicht aussehen zu lassen. Für dieses, wenn ich mich recht erinnere vom Berliner Feuilletonisten Friedrich Luft stammende Bonmot, liefert die französische Dramatikerin Yasmina Reza in den vergangenen Jahren immer wieder eindrückliche und international immens erfolgreiche Beispiele. Weil es ja nicht nur für das Körpertheater gilt, sondern genau so auch für die Musik- und Sprechbühne und das geschriebene Wort. In letzterem Genre hat sich Reza nun dem denkbar schwersten aller Themen angenommen: der Shoah und den Abgründen der Erinnerungskultur in ihrem bekannten Setting mittelgroßbürgerlicher Pariser Großfamilien.
Ein normal verkorkstes Exemplar einer solchen Familie hat nach dem Tod von erst dem Vater und dann der Mutter (beide Holocaust-Überlebende) die Idee, nach Auschwitz zu reisen. Als Familien-Reunion, als Spurensuche und Möglichkeit eines erneuten Zusammenfindens der Generationen mit ihren je eigenen Ansichten und Konsequenzen zur Shoah und den Toten in der Verwandtschaft. Allerdings nehmen die Beteiligten ihre je eigenen Beschädigungen mit auf die Reise. So kommt es, wie von Reza bekannt und geliebt, zu dem üblichen hochinteressanten Aneinandervorbeireden, Anzicken und sich wieder Liebhaben, den immer fluiden Koalitionen und Reibereien dieser Familie aus höchst individuellen Individuen, die die Vergangenheit – gewollt oder nicht, akzeptiert oder verleugnet – doch verbindet. Und das vor der mal überwältigenden mal profanen Kulisse des Todes so vieler in den Vernichtungslagern von Auschwitz und Birkenau.
Doch der Schrecken ist auch Fotomotiv. Die Balance zwischen gewitzter Dinner-Konversation mit milden Sticheleien und dem realen historischen Horror – auch diese säkular-jüdische Familie hat in Auschwitz und Birkenau Verwandte, Nachbarn und Freunde verloren – kann Reza durch ihr Ohr für die feinsten Nuancen in Unterhaltungen, durch genaue Beobachtung von trivial scheinendem, von den kleinen Schwächen und den charakterlichen Unzulänglichkeiten ihrer Protagonist:innen eben immer halten. Eine immense artistische Leistung von einer tief menschlichen Qualität. Weil das Buch so unordentlich und doch klarsichtig ist wie das Leben manchmal (selten).

Sommer in Odessa (Affiliate-Link)
Irina Kilimnik – Sommer in Odessa (Kein & Aber, 2023)
Der Krieg ist schon da, keine drei Autostunden entfernt. Es ist 2014, und russische Truppen haben die Krim besetzt, doch die Erzählerin, eine noch bei den Eltern wohnende Medizinstudentin in diesem „Sommer in Odessa“ versucht die Konsequenzen dieser neuen Lebenswirklichkeit so gut wie nur möglich auf Abstand zu halten. Die Turbulenzen im privaten sind schon überwältigend genug: die sprunghaften Freundschaften und an Missverständnissen reichen Beziehungen, die fragile Konstellation von Familie und Verwandtschaft und das ungeliebte Studium, das eher den Erwartungen der Großfamilie entspringt als ihren eigenen Vorstellungen vom Leben.
Zwischen Sowjet-Nostalgie und West-Orientierung grantelt sich die Familie entlang der sich langsam entfaltenden neuen Lebensrealitäten. Dem Dröhnen des Kriegs am Rand der Wahrnehmungsschwelle entspricht eine innere Unruhe, das Gefühl einer kommenden Umwälzungen (aber noch nicht jetzt, noch nicht gleich, noch nicht für mich) bei allen Figuren. Es zeigen sich Risse in Freundschaften und Beziehungen, auch Risse in der Familienstruktur, die tief verbuddelte Geheimnisse ans Licht bringen. Der Rückzug ins Private funktioniert einfach nicht mehr, die Politik grätscht immer wieder dazwischen und wirft Fragen auf: Was macht den Zusammenhalt einer Familie aus, was bedingt Freundschaft, ab wann muss man eine Seite wählen, sich für eine Position entscheiden, und wie ist das überhaupt möglich in einer russisch sprechenden Familie mit einem Selbstbild als wahlweise Ukrainer, Sowjets oder Europäer? Dass eine solche Komplexität subtil in eine ruhige Coming-Of-Age- Geschichte transportiert und federleicht konventionell erzählt werden kann, das ist keine unbeträchtliche erzählerische Kunst. Das in sonnenuntergangsmilde Melancholie gebettete Romandebüt der Ukrainerin Irina Kilimnik gibt Hoffnung, literarisch und auch sonst.

Backstein (Affiliate-Link)
Femke Vindevogel – Backstein (Steidl, 2024)
Einen Zugang zur eigenen Kindheit zu finden, ist nicht so einfach mit einem gewalttätigen Alkoholiker als Vater und einer innerlich (später ganz) abwesenden Mutter. Die Erzählerin von Femke Vindevogels „Backstein“ hat den permanenten psychologischen wie körperlichen Terror des Aufwachsens in einer solchen Familie als Erinnerung weitgehend ausgeblendet und sich eine punkige harte Schale zugelegt. Was es eben so braucht, um mit einem extrem narzisstischen Süchtigen klarzukommen, dessen Paranoia und Ordnungsfanatismus sich in DDR-Nostalgie und einer quasi-religiösen Umsetzung der autoritären Führungsprinzipien des Stalinismus auf die Familie äußert – und das im biederen flämischen Gent der 1980er-Jahre.
Als letzte Aktion vor dem Tod in einer geschlossenen Anstalt, als die Sucht soweit fortgeschritten war, das sie zu Korsakow und Demenz führte, hat sich der Vater noch in einem Mosaik-Kunstwerk verewigt, dessen in Säcke verpackte Einzelteile eines nasskalten Wintertages vor der Wohnung der Erzählerin stehen. Beim Zusammensetzen stellt sich heraus, dass Stücke fehlen. Und das Nachspüren dieser Stücke führt direkt in das Leben des Vaters, nach Ostberlin, wo sich bis dahin unbekannte Aspekte des väterlichen Lebens offenbaren und die zu dessen notorischem Größenwahn und den permanenten Lügengeschichten bestens passen. Vom Genter Schneematsch in das graukalt-miefige Dunstabzugshauben-Dieselabgas-Berlin (das ich schon lange nicht mehr so dermaßen trist beschrieben bekommen habe) ist für die Protagonistin der Schritt von einem Trauma zum nächsten, aber es zeigt eben auch einen Fluchtpunkt auf. Wenn die Kindheit eine überstandene Krankheit, wie die Erzählerin einmal die dänische Modernistin Tove Ditlevsen zitiert, dann ist die halbherzig begonnene, dann aber traumatisch tief in die Erinnerung führende Reise der Erzählerin in ihre weggesperrte Kindheit ein erster schmerzhafter Schritt zu einer Art Heilung. Und das ist wirklich sehr zart und schön erzählt.