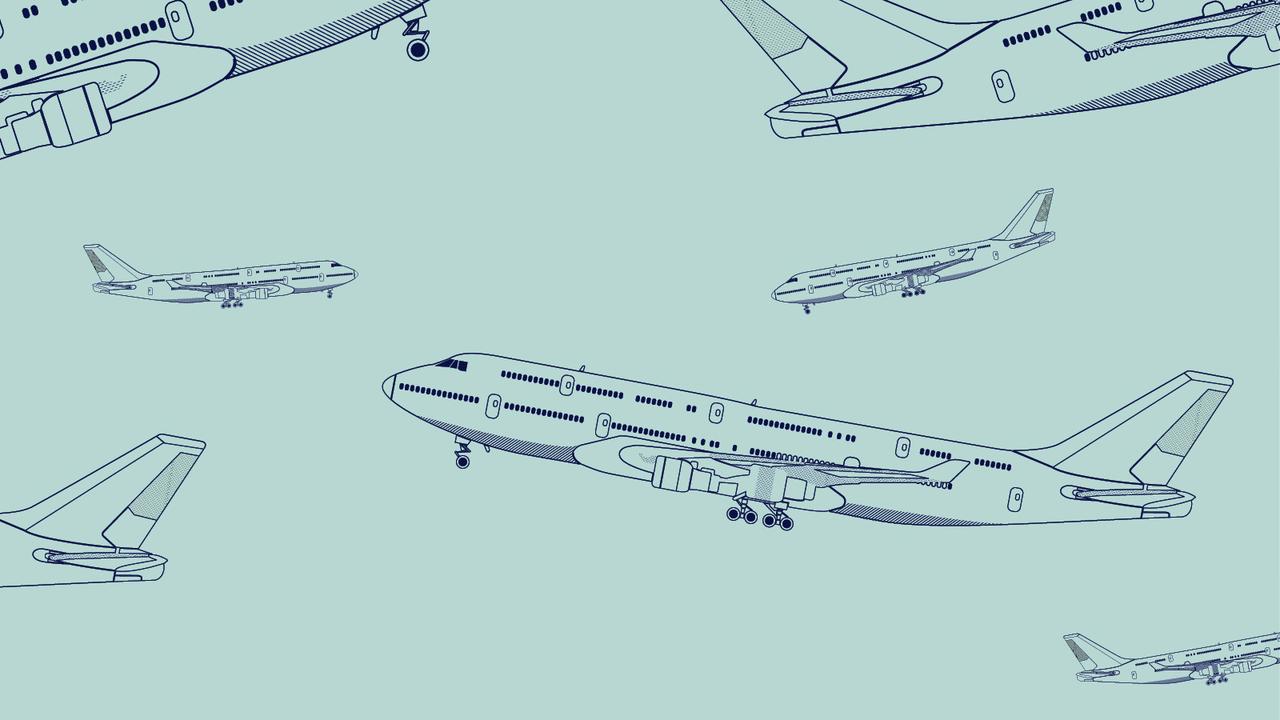Leichen pflastern seinen Weg„The Knick“: Steven Soderberghs neue Krankenhausserie
20.8.2014 • Film – Text: Tim Schenkl
Foto: Cinemax
Immer mehr Hollywood-Regisseure arbeiten neuerdings auch fürs Fernsehen. Für den amerikanischen Pay-TV-Sender Cinemax versucht sich nun Steven Soderbergh am Seriellen. Tim Schenkl hat sich die ersten beiden Episoden von The Knick angeschaut.
Ein Qualitätsurteil über eine neue Fernsehserie nach ihren ersten beiden Folgen abgeben zu wollen, ist kein leichtes Unterfangen und wahrscheinlich auch unfair dem behandelten Werk gegenüber. Denn eigentlich werden die ersten Episoden einer neuen Serie vor allem immer für die Vorstellung der Charaktere und der vorrangigen Konflikte sowie für die Setzung eines bestimmenden Erzählstils verwendet. Ästhetische Eigenheiten und besondere erzählerische Raffinessen werden daher erst nach einigen Folgen deutlich, häufig sogar erst nach einigen Staffeln. Eine genreprägende Serie wie The Wire begann beispielsweise erst mit der dritten Staffel, sich von gewöhnlichen Polizeiserien deutlich abzuheben, indem der diegetische Handlungsraum immer mehr aus dem Polizeirevier an andere Schauplätze Baltimores, wie in eine Zeitungsredaktion und in das Rathaus, verlagert wurde.
Viele Comedies nehmen erst mit der zweiten oder dritten Staffel richtig Fahrt auf, da die Szenen, Dialoge und Punchlines den Charakteren nun wie auf den Leib geschrieben erscheinen und das Drehbuch den bei den Zuschauern besonders beliebten Nebendarstellern größere Bedeutung einräumt. Auch ein Sensationserfolg wie Breaking Bad wurde erst so richtig gut mit seiner fünften und letzten Staffel. Für diese stand Showrunner Vince Gilligan und seinem Team recht offensichtlich ein deutlich höheres Produktionsbudget zur Verfügung, was der Serie einen wesentlich kinematographischeren Anstrich verlieh.

Foto: Cinemax
Eine gewisse Tendenz in der amerikanischen Serie
Während die Klassiker der amerikanischen Qualitätsserien wie The Wire, The Sopranos oder Mad Men ihre Faszination fast ausschließlich aus ihren ungewöhnlichen und zwiespältigen Charakteren und aus dem an den Gesellschaftsroman des frühen 20. Jahrhunderts erinnernden, epischen Erzählstil speisten, der einen neuen, tiefgründigeren Blick auf bereits bekannte Thematiken möglich macht, wird in den letzten Jahren immer mehr ein aus dem Blockbuster-Kino bereits bekanntes Umdenken der Produzenten und TV-Sender sichtbar: So gleichen viele der neuen Serien nun immer mehr einem geschickt geschnürten Paket als einem genuinen Kulturprodukt. Denn während James Gandolfini und Jon Hamm noch allein anhand ihrer TV-Rollen als Toni Soprano und Don Draper zu Ikonen der modernen Populärkultur wurden, drängen heutzutage aufgrund der immensen internationalen Beliebtheit vieler amerikanischer Serien auch immer mehr etablierte Hollywoodstars auf den TV-Markt, wo sie seit kurzem dann häufig noch mit den Starregisseuren der Traumfabrik gepaart werden: Dustin Hoffmann und Michael Mann, Kevin Spacey und David Fincher, Steve Buscemi und Martin Scorsese.
Eigentlich spricht wenig gegen solche Symbiosen auf dem heimischen Bildschirm. Betrachtet man die Ergebnisse jedoch genauer, so stellt sich schnell Ernüchterung ein. Denn als Zuschauer drängt sich einem bald der Eindruck auf, dass besonders die Regisseure, die meist nur die Pilotfolge selbst inszenieren und später dann als ausführende Produzenten fungieren, dem für sie ungewohnten Medium selten etwas Eigenständiges hinzufügen können. Zwar wird auch bei den neueren Serien, die Diedrich Diederichsen einmal sehr treffend als die neuen Supergroups beschrieb, weiterhin auf die bekannte Erfolgsformel aus zwiespältigen Charakteren und epischem Erzählstil gesetzt (auf den unzensierten Bezahlsendern gerne noch gepaart mit Nacktheit und sprachlicher Obszönität). Trotzdem wirkt Manns Luck einfach nur uninspiriert, Finchers House of Cards bestenfalls routiniert und Scorseses Boardwalk Empire vornehmlich auf das Exponieren von Schauwerten konzentriert. Und bei Gus van Sants und Jane Campions Ausflügen ins TV Boss und Top of the Lake sieht es nicht wirklich besser aus.
Ein wenig Skepsis scheint also mehr als angebracht, wenn man von den Plänen von ARD und ZDF hört, nun endlich auch relevante Serienformate produzieren zu wollen – und dann mit Tom Tykwer, der Berlin Babylon verfilmen will, und Matthias Glasner, der eine Serie mit Jürgen Vogel und Thomas Heinze dreht, in erster Linie auf bekannte Namen gesetzt wird.
„Welcome to the Circus“
Nun hat also auch Steven Soderbergh mit The Knick den Sprung in das Seriengeschäft gewagt. An seiner Seite steht der britische Filmstar Clive Owen, der die Hauptrolle übernimmt und ebenso wie Soderbergh auch als Produzent an dem Projekt beteiligt ist.
Finanziert wird das ganze durch den HBO-Schwestersender Cinemax.
Soderbergh, der bereits häufiger angekündigt hatte, dem Filmgeschäft endgültig den Rücken kehren zu wollen, hat lobenswerterweise gleich bei allen zehn Folgen der ersten Staffel von The Knick die Regie übernommen (eine zweite Staffel hat der Sender bereits vor der Ausstrahlung der ersten Folge bestellt). Außerdem zeigt der Regisseur sich unter seinem Pseudonym Peter Andrews auch für die Bildgestaltung der Serie verantwortlich. Gedreht wurde digital auf der Red Epic, klinisch steril kommt The Knick aber trotzdem ganz und gar nicht daher. Im Gegenteil!

Foto: Cinemax
New York im Jahre 1900: Der Oberarzt John Thackery (Clive Owen) wird, wie abgemacht, um 7.30 Uhr von einer sehr leicht bekleideten Prostituierten in einer Opiumhöhle geweckt, einige Blocks entfernt von seinem Arbeitsplatz, dem Knickerbocker Hospital. Mit der Kutsche macht er sich auf den Weg zur Arbeit. Auf seiner Fahrt durch das morgendliche New York passiert er einen Pferdekadaver, doch der Arzt hat keine Zeit, das tote Tier zu bemitleiden, denn er muss sich seine tägliche Dosis Kokain spritzen. Noch findet er eine geeignete Vene in seinem Fuß, einige Tage später wird die Schwester Lucy Elkins (Eve Hewson) ihm seinen Schuss in den Penis setzen müssen. Im Krankenhaus angekommen, geht es sofort in den OP. Gemeinsam mit seinem Freund und Vorgesetzten Dr. Jules M. Christiansen (Matt Frewer) soll Thackery ein Baby per Kaiserschnitt auf die Welt holen. Nach einigen extrem grausam anzuschauenden und blutigen Minuten sind Mutter und Kind tot.
In den ersten Szenen von The Knick etabliert Soderbergh gleich die Ästhetik, auf die sich die Zuschauer in den kommenden Episoden einstellen müssen. Eine rastlose Handkamera, die in rauen, ja fast ruppigen, extrem weitwinkligen und oft untersichtigen Bildern einen Blick auf eine Profession zeigt, deren Ausübende weder über das ausreichende Wissen noch über die benötigten Werkzeuge verfügen, um ihren Patienten angemessen helfen zu können und die an dieser Ausweglosigkeit zu zerbrechen drohen. Dazu wummern die elektronischen Synthesizerklänge von Cliff Martinez durch die Boxen des TV-Apparats.

Foto: Cinemax
Der Operationssaal des Knickerbocker Hospitals erscheint wie eine Mischung aus Hörsaal und Theaterbühne: Die Chirurgen erklären jede ihrer Aktionen einem aus Studenten und Kollegen bestehenden, gespannten Publikum, das es gewohnt zu sein scheint, dass scheinbar ein Großteil der Operationen kein gutes Ende für die Patienten nimmt. Das anschließende Händewaschen der operierenden Ärzte inszeniert Soderbergh daher auch mehr als rituelle Waschung denn als notwendigen Reinigungsakt. Dr. Christiansen scheint sich seiner Schuldgefühle dadurch jedoch nicht komplett entledigen zu können und setzt seinem Leben nach nur zehn Minuten der ersten Episode durch eine Kopfschuss ein Ende. Dr. Thackery muss seine Nachfolge antreten und verstrickt sich so noch tiefer in einen Krankenhausalltag, der geprägt ist von Geldmangel, Rassismus, Korruption, sozialer Ungerechtigkeit und zwischenmenschlichen Abhängigkeiten.
Das Drehbuch von The Knick wird regelrecht soderberghisiert. Sonderlich aufregend macht dies die Sache jedoch nicht.
Neben einem visuellen Stil etabliert Steven Soderbergh in den ersten beiden Episoden von The Knick, das in Amerika immer am Freitagabend ausgestrahlt wird und das Sky Go-Kunden im Original nur wenige Stunden später als Video-on-Demand-Angebot zur Verfügung steht, auch einige vielversprechende Charaktere, die vermutlich im weiteren Verlauf der Handlung noch entscheidende Rollen spielen werden. Hiervon sind vor allem zu nennen: der schwarze Arzt und Harvard-Absolvent Dr. Algernon Edwards (André Holland), den Thackery aufgrund seiner Hautfarbe für nicht geeignet für das Knickerbocker Krankenhaus hält, und die rauchende Nonne Harriet (Cara Seymour), die außerhalb des Hospitals schwangeren Frauen bei der Abtreibung zur Seite steht.

Foto: Cinemax
Die Hoffnung stirbt zuletzt
So weit so gut. Doch wird es Steven Soderbergh gelingen, mit The Knick mal wieder eine Serie abzuliefern, bei der man nicht spätestens nach der zweiten Staffel desinteressiert und enttäuscht das Sehen einstellt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Leider gibt es jedoch schon jetzt einige Anzeichen dafür, dass auch Soderbergh nicht in der Lage ist, Substantielles abseits der großen Leinwand zu produzieren. Denn so sehr die Kamera auch wackelt, eine Neue Welle wird hier nicht losgetreten. Eher hat man das Gefühl, die aus Soderberghs Spielfilmen bereits bekannten Trademarks – der schmutzige Kamerastil, die häufigen Blau/Orange-Kontraste im Lichtdesign und der pulsierende Elekro-Soundtrack – werden hier mit einer gewissen Penetranz und auf Teufel komm raus einer doch relativ klassischen erzählerischen Ausgangssituation übergestülpt. Das Drehbuch von The Knick wird regelrecht soderberghisiert. Sonderlich aufregend macht dies die Sache jedoch nicht.
Der Eindruck fehlender Originalität wird noch dadurch verstärkt, dass die Hauptfigur, ein eigenbrötlerischer, genialer, drogenabhängiger Arzt, der einen rauen Umgangston mit seinen Kollegen und Vorgesetzten pflegt, doch etwas sehr stark an Hugh Lauries Rolle in House, MD erinnert und John Thackery somit wie ein Vorgänger von Gregory House erscheint, allerdings ohne dessen sarkastischen Witz. Doch wer weiß, vielleicht gelingt es Soderbergh ja im Gegensatz zu so vielen seiner berühmten Regie-Kollegen im Verlauf der Serie doch noch, seine professionelle Routine abzulegen und mehr aus The Knick zu machen als ein reines Star-Vehikel für sich und seinen Hauptdarsteller.