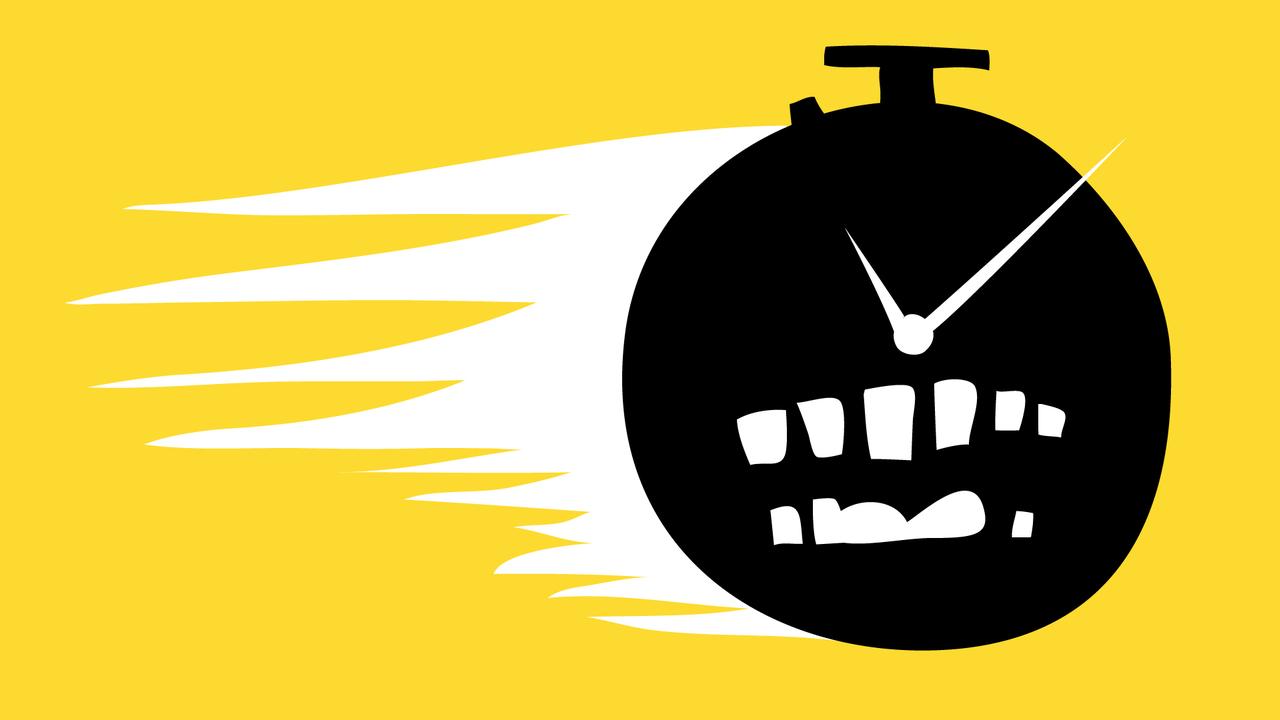Water Works – Geschichten aus Südafrikas WasserkriseTeil 2 | Wellen aus Blut
27.1.2020 • Gesellschaft – Text & Fotos: Julia Kausch
Surfers Corner, Muizenberg
Im zweiten Teil der Serie „Water Works“ paddelt Autorin Julia Kausch mit dem Bord raus auf den Ozean. Die Idylle trügt nicht nur im Wasser.
Wasser ist ein kostbares und endliches Gut. Wie kostbar es wirklich ist, lässt sich mittlerweile auch hierzulande ob des dramatischen Klimawandels immer mehr erahnen. Wasserknappheit ist schon lange kein Problem mehr, das wir als wohlstandsverwöhnte Europäer ignorieren können. Andere Regionen sind noch schlechter dran. Ab 2015 sah sich die südafrikanische Provinz Westkap mit einer dramatischen Situation konfrontiert: Dürre und Trockenheit ließen die Wasserreserven der Region gefährlich schwinden. Anfang 2018 schließlich wurden die Szenarien für den „Day Zero“ veröffentlicht, dem Tag, an dem das Wasser aufgebraucht sein würde. Genau in dieser Zeit fuhr Filter-Autorin Julia Kausch nach Südafrika. Um das Land kennenzulernen, vor allem aber auch, um zu surfen und sich dem Wasser der Ozeane kompromisslos auszusetzen. In ihrer Artikel-Serie „Water Works“ erzählt sie Geschichten rund um das Wasser in Südafrika. Episodisch und reportierend setzt sich so Stück für Stück oder Welle für Welle das Bild einer Krise zusammen, die von weit mehr abhängig ist als vom resourcenschonenden Umgang und der Hoffnung auf Regen.
Wir zwei haben es geschafft. Mein Board und ich sind in Kapstadt, wobei ich ihm bisher noch keine Sehenswürdigkeiten zeigen konnte. Zwar ist es schon ein bisschen rumgekommen, aber eben noch nicht hier. Indonesien, das wellenarme Deutschland und nun Südafrika. Nach etwa einer Woche im stinkigen Century City, nicht olfaktorisch aber doch gefühlstechnisch stinkt es mir ordentlich, mache ich mich auf den Weg nach Muizenberg im Süden Kapstadts, das Brett auf meinen Mietwagen geschnallt – dem Indischen Ozean entgegen. Dieser ist, den Temperaturen nach, eindeutig die erste Wahl. Im weißen Hyundai Atos – das Auto hatte ich in der Vorwoche glücklicherweise tauschen können –, ohne Airbags, aber mit Klimaanlage geht es also auf der N1 gen Süden. Ich denke an Chas Smith und sein Auto der Wahl, wann immer er am North Shore Hawaiis unterwegs ist – ein weißer Mitsubishi Spider Convertible. Die unerotische, doch lokal angebrachtere Version ist dann wohl mein Atos. Verkehrstechnisch orientiert man sich natürlich links und eher selten in Cabrios. Ich nehme die Südtangente der M5, welche mich um den Tafelberg herum leitet. Vorbei an Athlone, Kenilworth und Plumstead werde ich auf der Autobahn schnurstracks in das zwielichtige Retreat gespuckt. Wie ich später an diesem Tag herausfinden sollte, war dort gerade ein Protest am Laufen. Es geht um die Schaffung von Wohnraum für die ortsansässigen Menschen. Um die hier verqueren, um die Ecke gedachten politischen Verzweigungen zu verstehen, scheint man jedoch selbst Teil des Korruptionsnetzes sein zu müssen.
Ich passiere brennende Autoreifen und qualmende Metalltonnen, wütende Coloreds und Blacks – hier ist kein Grünstreifenindikator mehr nötig, um zu wissen, dass Retreat und das auf der anderen Seite liegende Lavender Hill nicht die besten Orte sind, als Frau alleine herumzufahren. Grün war hier sowieso schon lange nichts mehr – und bekomme am Samstagmorgen in meinem Auto das, was das Ganze noch schlimmer machte, so gar nicht zu meiner Street Credibility beiträgt, bei verriegelten Türen langsam Panik. Zwei kleine Jungen in kurzen Hosen und leuchtend roten T-Shirts stehen barfuß am Straßenrand und gucken mich mit verwundertem Blick an. „Was hält das blonde Mädchen in ihrem total ungeilen weißen Hyundai Atos ohne Airbags aber mit A/C, nur weil Rot ist?“ Jetzt doch ganz froh, nicht im weißen Mitsubishi Spider Cabrio zu sitzen, weil das nur noch indiskreter wäre, trete ich aufs Gaspedal und fahre über Rot. Die Jungs verfolgen mich noch eine Weile in meinen Gedanken. Ob sie mein Auto wirklich so scheiße fanden? Mental ohrfeige ich mich, weil ich – vielleicht aus Angst? – in stereotyp-europäischer Zentralperspektive total an Afrika vorbeidenke und bin froh, dass die zwei in Rot gekleidet waren. Zumindest bei mir scheint das noch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

15 Minuten später biege ich, linksherum durch den Kreisverkehr, in den Parkplatz der Surfer’s Corner ein. Muizenbergs Oceanfront am mit Surffanatiker*innen beladenen Beachbreak bildet eine bunte Oase, die gleichermaßen von Touristen, Hippies, Gen X, Y, Z, Babyboomern, Obdachlosen, Blacks und Coloured aufgesucht wird. Und wo die Obdachlosen meist vorm Bottleshop aufschlagen, finden sich Surfaffine im/um das Wasser versammelt, paddeln fröhlich darin herum oder starren sehnsüchtig auf die Wellen. Seemannswitwe? Seefrauswitwer? Wohl eher nicht, the stoke is real. Flankiert von kleinen Surf- und Coffeeshops, Restaurants, Boutiquen und Hostels längs zum Strand, einer Bahnstation zur Rechten und kleinen Beachhuts zur Linken, bildet ein längliches Gebäude an der Strandfront das Zentrum. „Shark spotter“ liest das Schild. Ein weiteres, kleineres Schild darunter beschreibt die neben dem Haus eingelassenen Flaggen, die gemächlich an den Masten wehen. Grün, so heißt es, bedeutet, dass kein Hai gesichtet wurde und die Sicht klar ist. Schwarz – immer eine gute Wahl, wie ich finde – besagt, dass zwar kein Hai in Sicht, diese aber nicht optimal ist. Rot kann man sich nun denken: HAI – besser nicht ins Wasser gehen. Heute weht Schwarz. Geht ja immer, dennoch ein Cop-Out, wie ich vor meiner ersten Session feststellen muss. Ich gehe zum Ufer, halte meine Zehen samt FlipFlop ins Wasser und Ausschau nach Rückenflossen. An den Menschenmassen im Wasser vorbeizusehen ist quasi unmöglich: Außer etwa 200 SurferInnen ist nichts zu sehen, und selbst das Wasser scheint stellenweise von einem Menschenteppich überzogen zu sein. Die Flagge, entscheide ich, ist spot on.
Um dem zwar wärmer als dem nahegelegenen Atlantik, aber immer noch arschkalten Indischen Ozean entgegenzuwirken, gehe ich zunächst in einen der frontal anliegenden Surfshops, um einen Wetsuit zu kaufen. „Lifestyle“ ist meine Wahl. Die ganze Angelegenheit stellt sich als schwieriger heraus als gedacht. Zunächst sind alle Anzüge, die ich anprobiere, viel zu groß, sodass keine optimale Isolierung möglich ist. Nach etwa drei Suits bin ich schweißgebadet; das Ganze hat mehr von einer Zwangsjacke als von dem doch so luftig-locker scheinenden Cowabunga-Dude-Lifestyle. Eine Kindergröße für Dreizehnjährige passt endlich. Praktisch, kostet auch nur die Hälfte. Großes Plus: Im grellen Neongelb findet man mich bei potentieller Haiattacke auch schneller. Ich zahle und lasse das Ding gleich an. Ich bin so platt, dass das Ausziehen sicher im Kollaps geendet hätte. Ich gehe zu meinem Auto und nehme das Bord vom Dach. Auch wenn mein letzter Surf etwas zurücklag, geht alles automatisiert: Wachs drauf, runter zum Strand, Leash dran – an den linken Knöchel, aber mit dem zugehörigen Begriff goofy habe ich mich schon abgefunden und kann mich ganz gut damit identifizieren. Goofy, weil: Die meisten Surfer*innen tragen ihre Leash rechts (regular), was bei rechtsbrechenden Wellen ideal ist, welche dann besser betrachtet werden können. Getestet wird das Ganze, in dem man die Person in Frage von hinten leicht schubst. Der Fuß, welcher nicht nach vorne ausfällt (das Standbein), entscheidet über die dann meist lebenslange Gruppenzugehörigkeit und damit einhergehende Identitätsbildung. Egal, los.
Mit meinem sieben Fuß langen Board gegen das Whitewash anzupaddeln, bin ich nach Monaten des Point Breaks nicht gewöhnt. Duck diving ist damit nicht möglich, also würde es ein wenig dauern, bis ich meinen Weg nach hinten erpaddele. Eher vor Erschöpfung, als weil die Wellen die kommen, nehme ich ein paar. Geht noch ganz gut. So langsam komme ich wieder rein und bahne meinen Weg zur Backline. Der Muskelkater ist mir sicher, denke ich, und gucke noch einmal, ob hinter den Menschenmassen die filmisch so oft überinszenierte Rückenflosse eines weißen Hais rausschaut. Natürlich suche ich genau nach den mir so bekannten Darstellungen. Dabei ist der weiße Hai ja am gruseligsten, wenn er gar nicht sichtbar ist. Anders als im gleichnamigen Film ertönt in Muizenberg allerdings eine Sirene, welche eine kollektive Panikattacke auslösend, alle dazu aufruft, das Wasser zu verlassen. Zumindest der Schlachtruf funktioniert gleich: GET OUT OF THE WATER! So ja auch bei Jaws. Aber bisher keine Sirene. Schlechte Sicht, kein Angriff. Ich bin erleichtert.
Ich sehe wohl schlimm aus, denn der Mob nimmt mein Board, legt mich auf den Rücken längs zum Indischen Ozean in den warmen Sand und beginnt, mir Watte in die Nase zu stecken. Die Menge inquiriert, ob die schon immer so schief war? Schwer zu sagen so ohne Spiegel.
Immer noch nicht hinten angekommen, kommt ein großes Set rein. Den Typ vor mir auf einem noch längeren Single Fin Longboard haut es von der Welle, die ihn wie im Waschmaschinenschleudergang einrollt. Sein Board hat er dabei nicht mehr unter Kontrolle. Es fliegt im Parabelflug in die Luft und landet: direkt auf meiner Nase. Auch ich werde von der einrollenden Welle geschluckt und weiß für eine Minute nicht mehr, wo oben und unten ist. Wahrscheinlich sind es nur wenige Sekunden, aber als ich auftauche, schnappe ich nach Luft. Ich suche mein Brett, die nächste Welle ist schon am Einlaufen und nochmal will ich das nicht erleben. Ich paddele nach rechts, glücklicherweise gerade an der Welle vorbei. Ich schaue auf mein weißes Board und sehe rote Tropfen, die mit dem salzigen Wasser verschwimmen. Ich fasse mir an die Nase, die erstaunlicherweise gar nicht wehtut, aber dem Anschein nach im Strahl blutet. Ich beginne meinen Weg zurück zum Strand und drehe mich kurz um: Wellen? Rückenflossen? Die einwaschenden Wellen tragen mich sanft zum Ufer. Alles gut, denke ich, als rund 20 Menschen auf mich zugerannt kommen. „What happened“, fragen sie durcheinander. Ich sehe wohl schlimm aus, denn der Mob nimmt mein Board, legt mich auf den Rücken längs zum indischen Ozean in den warmen Sand und beginnt, mir Watte in die Nase zu stecken. Die Menge inquiriert, ob die schon immer so schief war? Schwer zu sagen so ohne Spiegel. Langsam wird mir schwindlig. Das Blut strömt nun in Wellen aus meiner wärmer werdenden Nase, die ohne die Kälte des Ozeans zu pochen beginnt.

Mein Samstag endet im Krankenhaus in Century City, was etwa 40 Minuten entfernt liegt. Ein Bekannter fährt mich dort hin. Das Wartezimmer ist nach drei Stunden Warten klitschnass. Eine Salzpfütze umgibt mich im Drei-Meter-Radius. Ich habe immer noch meinen Wetsuit an; der immer enger werdenden Anzug fühlt sich hier, außerhalb des Wassers, im stickigen, stinkigen Krankenhaus in Century City, noch mehr wie eine Zwangsjacke an, aus der es für den Moment kein Entkommen gibt. Ich denke an Muizenberg und hoffe inständig, dass mein blutiges Ende zum ersten Surfversuch in Südafrika keine Haiattacken zur Folge hatte. Zurück, wo es mir stinkt, warte ich auf die Ärztin. „Nasenbruch“, sagt sie. „Und jetzt?“, frage ich. „Kann man nichts machen, das muss erst verheilen“, erklärt sie. Erst dann könnte man die Nase noch einmal brechen, um sie zu richten. Aha. Sie fragt, wo denn der Unfall passiert sei. „Muizenberg“, antworte ich. Ob ich auch den Protest gesehen hätte? „Ja“, sage ich. Sie blickt mich besorgt an – ich muss wohl noch viel lernen über das Leben in Afrika. Ich fahre nach Hause – keine Ampeln, nur Kreisverkehre. Für heute habe ich genug Rot gesehen.
Der dritte Teil von „Water Works“ erscheint am 12. Februar.