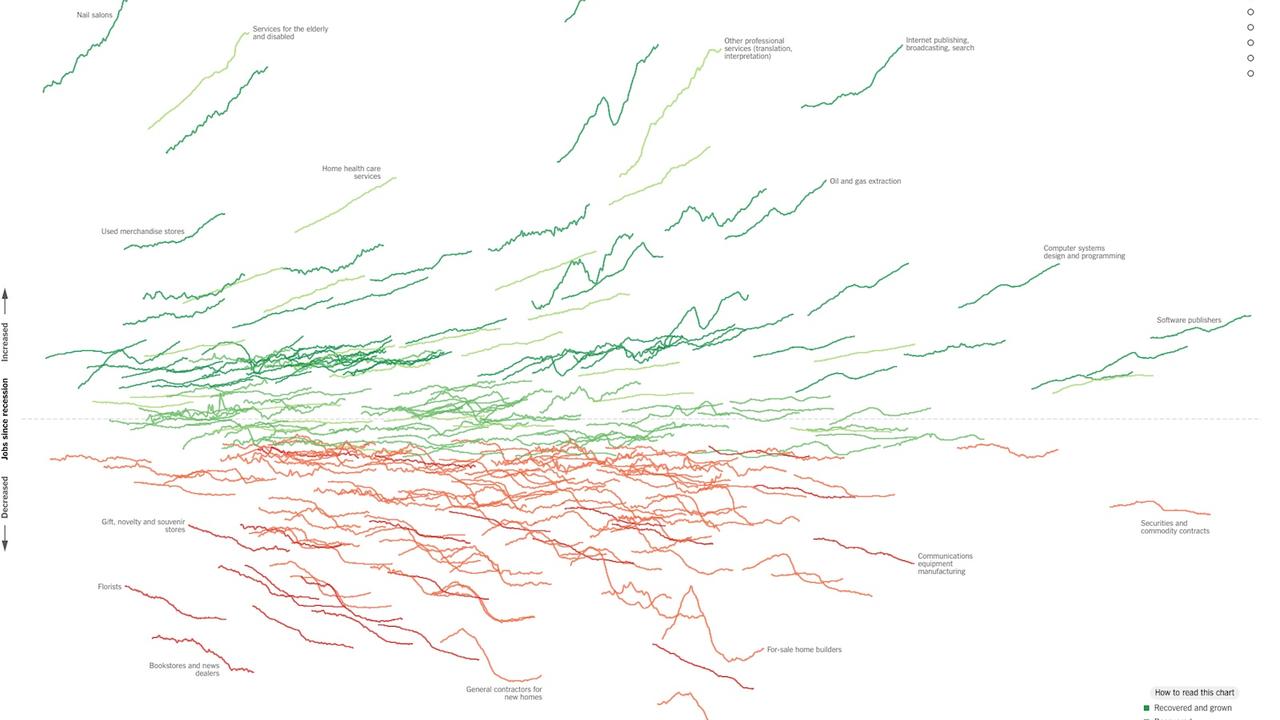„Meinen Eltern war egal, ob ich lesen kann.“Analphabetismus in Berlin
18.6.2014 • Gesellschaft – Reportage: Monika Herrmann
Bild: Young male reading an empty open book on a desk via Shutterstock
In Deutschland leben rund 7,5 Millionen Analphabeten, 300.000 davon in Berlin. Deutschland steht damit im europäischen Vergleich nicht sonderlich gut da, auch wenn verlässliche Statistiken rar sind. Monika Herrmann hat den „Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe" in Berlin-Kreuzberg besucht. Hier können junge und alte Menschen das nachholen, was sie in der Schule versäumt haben. Aus welchen Gründen auch immer.
Lorenz hat sich zum Gespräch Kaffee mitgebracht. An der Tasse hält er sich ein bisschen fest, denn es fällt ihm nicht leicht, einer Journalistin seine Geschichte zu erzählen. Lorenz ist 51 und Analphabet. „Ich hab das in der Schulzeit nicht hingekriegt und war totaler Außenseiter. Andere haben über mich gelacht, mich nicht für voll genommen“, erzählt der hagere Mann. Seine Haare hat er zum Pferdeschwanz zusammengebunden. An einem heißen Sommertag berichtet er von Lehrern, die sich nicht gekümmert haben um ihn. „Ich bin so mitgeschleppt worden“. Auch seinen Eltern war es egal, dass der Sohn nicht lesen und schreiben konnte. Nach der Schulzeit bekam er Jobs, in denen sein Handicap keine Rolle spielte. „Ich hab als Tischler gearbeitet, später als Dachdecker, die Chefs hat das alles nicht interessiert. Weil sie meine Arbeit geschätzt haben“. Aber wenn er mit der U-Bahn oder dem Bus unterwegs war, begannen die Probleme. „Ich musste fragen, weil ich nicht wusste, in welche Richtung der Zug geht und hab dann Ausreden benutzt: Dass ich die Brille nicht dabei habe zum Beispiel.“ Richtig schlimm wurde es, erzählt er, wenn ich mal eine Unterschrift leisten oder ein Formular ausfüllen musste. „Das ging gar nicht“. Auch die Freundin hatte keine Ahnung von Lorenz’ Problemen. „Niemand wusste das, ich habe mich geschämt“. Als er seinen Dachdeckerjob verlor, rutschte der damals 25-Jährige richtig ab: Alkohol und Drogen bestimmten lange sein Leben und machten seinen Körper krank. „Ich bin jetzt Frührentner“, sagt er und trinkt aus seinem Kaffeebecher ehe er von seinem neuen Leben erzählt. Ohne Drogen und Alkohol.
Aber das wichtigere für ihn: Er lernt jetzt lesen und schreiben. Lorenz ist nun ein „Lerner“. So werden Menschen wie er beim Arbeitskreis Orientierungs-und Bildungshilfe (AOB) genannt. Ein Verein, der sich seit fast 40 Jahren um erwachsene Analphabeten kümmert. Im Klartext: Beim AOB in Berlin-Kreuzberg gibt es Lernkurse für sie. Mehrmals in der Woche und in kleinen Gruppen holen Menschen wie Lorenz das nach, was sie in der Schule nicht geschafft haben. Der Lerner zieht eine Broschüre aus dem Stapel, beugt sich über den Text und beginnt vorzuführen, was er schon kann: Ganz langsam und mühsam geht das. Silbe für Silbe zieht er die Wörter zusammen. „Lesen geht schon“, sagt er, „aber schreiben?“ Da muss er wohl noch einiges tun.
Eine Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2011 unterscheidet bei Analphabeten zwischen verschiedenen Kategorien.
Funktionaler Analphabetismus betrifft demnach 14 % der erwerbstätigen Bevölkerung (Alter: 18-64 Jahre). Das entspricht 7,5 % Menschen in Deutschland. Die Studie spricht vom „Unterschreiten der Textebene“. Das heißt: Die Betroffenen können zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, nicht aber zusammenhängende kurze Texte. Sie sind nach Ansicht der Experten nicht in der Lage am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. In Deutschland sind 15 % der funktionalen Analphabeten in der Gruppe der 18-29-Jährigen zu finden. Weitere 27 % in der Gruppe der 40-49-Jährigen und 37 % bei denen zwischen 50 und 64-Jährigen.
Weitere 25 % der erwerbstätigen Bevölkerung (13 Millionen Menschen) schreiben und lesen fehlerhaft. Betroffene vermeiden Lesen und Schreiben deshalb häufig. Von Analphabetismus im eigentlich Sinn, so die Studie, seien vier Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung betroffen. Sie können lediglich einzelne Wörter Buchstabe für Buchstabe lesen und schreiben und zusammensetzen. 4,4 Millionen der funktionalen Analphabeten haben Deutsch als Erstsprache gelernt, weitere 3,1 Millionen lernten zuerst eine andere Sprache. Die Experten gehen davon aus, dass auch mindestens 12 % der Menschen mit höherer Bildung Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. (Vgl. 50 % ohne bzw. untere Schulabschlüsse)
Lorenz ist einer von rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben können. 300.000 Betroffene sind es in Berlin. „Das war vor 40 Jahren schon so und an der Struktur hat sich nichts geändert“, sagt Margret Müller, eine der Dozentinnen bei AOB. Müller, die Erwachsenenbildung studiert hat, spricht vom „funktionalen Analphabetismus“, der jeweils mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Dann erzählt sie von Menschen, die kommen, weil sie sich völlig am Rand der Gesellschaft fühlen, ganz unten, nicht anerkannt und oft ohne jede Hoffnung. Jüngere und Ältere gleichermaßen. Sie wollen ihr Leben ändern und endlich lesen und schreiben lernen, weil sie dazugehören möchten. In kleinen Gruppen sitzen die Lerner dann zusammen, reden über ihre Probleme und machen sich auch gegenseitig Mut, lesen Wörter, später Texte und schreiben irgendwann vielleicht eine kleine Geschichte, können eine Zeitung lesen oder ein Buch. Zur Zeit lernen rund 50 Analphabeten beim Verein. Die Arbeit wird vom Berliner Senat gefördert, die Kursteilnehmer zahlen eine Gebühr von zehn Euro pro Monat. Eine großzügige Fabriketage mit schönen modernen Möbeln ausgestattet ist der Ort, an dem sich das Leben von ihnen verändert. Eine kleine Kaffeeküche ist dabei und ein Raum mit Computern. Installiert sind Lernprogramme, aber die Lerner bekommen auch die Möglichkeit, sich mit dem Internet vertraut zu machen.
„Es ändert sich - trotz Fördermaßnahmen in den Schulen – nichts, weil die Politiker kein Geld freimachen für gezielte, Förderung von Kindern und deren Familien.“
Müller sagt, dass jeder Lerner andere Voraussetzungen mitbringt: „Die einen haben bereits Computerkenntnisse, andere können kein einziges Wort schreiben und lesen, den meisten fällt es schwer, einen zusammenhängenden Text zu erfassen. Und wieder andere können ein bisschen lesen, aber kaum schreiben“. Die Dozentin kritisiert die Bildungspolitik: „Es ändert sich - trotz Fördermaßnahmen in den Schulen – nichts, weil die Politiker kein Geld freimachen für gezielte Förderung von Kindern und deren Familien.“ In den Schulen fehlten Sozialpädagogen, Psychologen und Lerntherapeuten. Wenn die ersten drei Lebensjahre verstreichen, in denen Kindern nicht vorgelesen wird und sie selbst auch keine Bücher in die Hand bekommen, sei der Zug eigentlich schon abgefahren. Zum Bildungsnotstand in den Familien kommen andere Probleme hinzu. Müller erzählt von einer jungen Frau, die zum AOB kam und sagte, dass sie es satt habe, ständig neue Ausreden zu erfinden oder andere um Hilfe zu bitten, dass sie jetzt endlich lesen und schreiben lernen will. „Sie hat mir berichtet, dass sie sexuelle Gewalt erlebt hat, in einer Förderschule gelandet ist, sich aussortiert fühlte und mit allen Problemen immer allein war.“ Als Lernerin änderte sich ihr Leben zum Positiven. Wer nicht lesen und schreiben kann, lebt gefährlich: Er kann zum Beispiel keine ärztlichen Anweisungen lesen, keine Beipackzettel entziffern, um etwas über Nebenwirkungen der Medikamente zu erfahren. Richtig schlimm wird es, wenn die Betroffenen bei öffentlichen Ämtern ertappt werden, beim Job-Center zum Beispiel. In der Lerngruppe werden sie auch ermutigt mit ihrer Beeinträchtigung offen umzugehen. Aber das ist gar nicht so einfach. Manche brauchen eine therapeutische Begleitung, manche brechen den Kurs ab. „Weil es einfach zu viel wird für sie“, sagt Müller.
##Kreatives Lernen
Der weite Weg zum AOB sei so eine Schranke. Wie komme ich da hin und was ist, wenn die Bahn ausfällt und Ersatzverkehr angeboten wird? Wen frage ich und wie merke ich mir dann die neue Wegstrecke? Das sind Fragen, die eigentlich nur die Betroffenen selbst verstehen können. Müller und ihre Kolleginnen wünschen sich deshalb mehr Orte, wo solche Kurse stattfinden könnten: Sie denkt an Nachbarschafts- oder Kiez-Treffpunkte. Wenn die Lerner nur um die Ecke gehen müssen, sagt Müller, fällt es ihnen leichter, die Kurse auch durchzuhalten. Und dann erzählt sie noch von den Lerninhalten, die von Lernern selbst erarbeitet werden und die sich mit ihren Alltagserfahrungen decken. Keine Diktate oder Aufsätze: Kreatives Lernen ist angesagt. Eine Lernerin hat ein Spiel sozusagen erfunden, in dem Texte ergänzt werden müssen.
„Wir konnten halt andere Sachen."
Darauf freut sich Karla schon. Sie will auch mit der Journalistin reden und ihre Geschichte erzählen. Karla ist 71 und gehört seit einem knappen Jahr zu den Lernern beim AOB. Die kleine rundliche Frau mit den blond gefärbten Haaren ist in der Nachkriegszeit auf dem Land aufgewachsen. „Dass einige in der Dorfschule nicht lesen und schreiben konnten, ist gar nicht aufgefallen“, sagt sie und dass ihre Mutter die Hausaufgaben für sie erledigte. Als sie heiratete, merkte sie, dass ihr Mann auch nicht lesen und schreiben konnte. „Das war damals so“, lacht sie. „Dafür konnten wir andere Sachen“. Doch Karla hat sich Märchenbücher gekauft und sich das Lesen selbst Stück für Stück beigebracht. „Das ging dann ganz gut, aber schreiben konnte ich nicht“. Bis sie sich von ihren Kindern dann ein bisschen was abschaute. Jetzt will sie alle Defizite aufholen. In einem Alter, in dem sich andere ausruhen und vielleicht schöne Reisen machen, lernt Karla. Sie macht Fortschritte und ist stolz darauf. „Neulich musste ich einen Antrag ausfüllen“, erzählt sie. „Und das hat geklappt“. Ob alles fehlerfrei war, weiß sie nicht. „Aber ich habe jetzt keine Angst mehr, der Bankerin bei der Sparkasse zu sagen, dass ich nicht so gut schreiben kann und sie sich noch mal das Überweisungsformular ansehen soll. Ist doch nicht so schlimm, oder?“