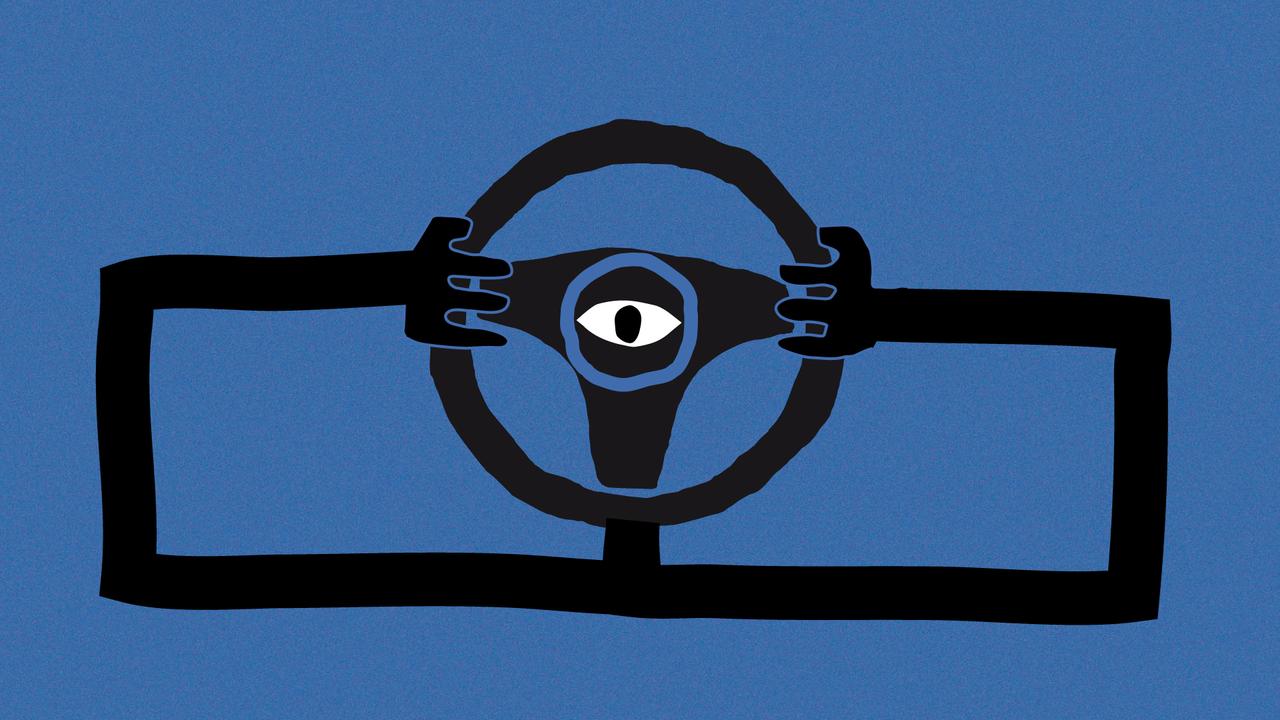„Ich habe Angst, abgeschoben zu werden“Khadim Qorbani war 20 Jahre auf der Flucht – ob er in Berlin bleiben darf, weiß er nicht
26.10.2018 • Gesellschaft – Interview: Monika Herrmann
Khadim Qorbani war elf Jahre alt, als seine Eltern vor seinen und den Augen seiner Brüder erschossen wurden. Damals, im afghanischen Chazni, machten die Taliban kurzen Prozess mit der Opposition. Um selbst nicht auch getötet zu werden, beschlossen seine drei älteren Brüder, das Land zu verlassen, und nahmen Khadim mit. Ihr Ziel: Europa. Seit vier Jahren ist Khadim nun in Berlin. Insgesamt 20 Jahre dauerte die Flucht, während der er von seinen Brüdern getrennt wurde. Monika Herrmann hat ihn getroffen: in einer Wohngemeinschaft für alte Menschen, die an Demenz leiden. Hier arbeitet Khadim als Altenpfleger-Helfer. Ist jetzt alles gut? Nein, sagt Khadim, denn ihn umtreibt die Angst, abgeschoben zu werden.
Khadim, Ihre Eltern wurden von den Taliban erschossen, vor ihren Augen. Das ist lange her. Erinnern sie sich an diese Situation?
Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Als meine Eltern erschossen wurden, war ich ein kleiner Junge. Elf Jahre alt. Ich konnte dieses Drama eigentlich gar nicht richtig verstehen. Aber der Mord geschah ja vor meinen und den Augen meiner Brüder. Wir hatten plötzlich keine Eltern mehr. Wahrscheinlich haben wir geweint, aber ich weiß das nicht mehr. Ich erinnere mich aber, dass sich Nachbarn um uns Brüder gekümmert haben. Wahrscheinlich haben sie auch die Bestattung unserer Eltern organisiert. Aber dann ...?
Sie haben mir erzählt, dass Ihr ältester Bruder beschloss, dass sie alle zusammen das Land verlassen, Richtung Europa.
Ja, mein Bruder befürchtete wohl, dass wir auch ermordet werden. Er war damals selbst in der Opposition und kämpfte gegen die Taliban. Er hatte Angst, auch um uns jüngere Geschwister. Und das leuchtete uns natürlich ein. Dann gingen wir einfach los. Erst nach Pakistan, dann kamen wir in den Iran, in die Türkei, nach Griechenland, Italien, Frankreich. Unsere Wege trennten sich aber im Laufe der Jahre. Vor vier Jahren kam ich nach Deutschland.
„Wir haben versucht Arbeit zu finden. Das war uns total wichtig. Denn wir wollten ja ein relativ normales Leben führen.“
Ihre Flucht dauerte 20 Jahre. Erzählen sie, wie das war, ohne Geld, ohne Hilfe nach Europa zu kommen.
Zuerst durchquerten wir Pakistan. Mal gingen wir zu Fuß, mal fuhren wir mit dem Auto zusammen mit anderen. Ich war ja noch ein Kind und konnte die politischen Verhältnisse nicht so einschätzen, aber ich vertraute meinen älteren Brüdern. In den Ländern, die wir durchquerten, blieben wir immer ein paar Jahre. Meine Brüder und später dann auch ich selbst versuchten, Arbeit zu finden. Das war uns total wichtig. Denn wir wollten ja ein relativ normales Leben führen. Jeder hatte da so seine eigenen Vorstellungen. Aber ich wollte nach Deutschland. Das war immer mein Ziel und ich habe es geschafft.
„Mein ältester Bruder wurde aus der Türkei abgeschoben und nach Afghanistan zurückgebracht.“
In den jeweiligen Ländern haben Sie also immer eine ziemlich lange Zeit gelebt. Wie wurden sie denn von den Menschen dort aufgenommen?
Das war unterschiedlich. Natürlich waren wir Fremde, wir kannten weder die Sprache, noch die Lebensweise. Aber wir haben versucht Geld zu verdienen. Jeder für sich. Damals gab es auch noch nicht so viele Flüchtlinge wie heute. Vielleicht war es deshalb nicht so schwierig für uns. Ich habe zum Beispiel in der Türkei einen Schneider kennengelernt, der mir anbot, bei ihm eine Lehre zu machen. Gleichzeitig konnte ich bei ihm wohnen und die türkische Sprache habe ich so auch noch ganz nebenbei gelernt. Meine Brüder haben auch verschiedene Möglichkeiten genutzt. Mein ältester Bruder wurde aber abgeschoben und nach Afghanistan zurückgebracht. Es war also alles sehr ungewiss. Wir wussten oft nicht, wie es weitergehen soll, wohin wir gehen sollen und in welchem Land wir auch weiter leben könnten.
Was ist mit ihrem Bruder passiert, nachdem er nach Afghanistan wieder abgeschoben wurde?
Das weiß ich nicht. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört und weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Auch die anderen Brüder sind dann im Laufe der Zeit ihre eigenen Wege gegangen. Nur ich bin in Deutschland gelandet. Aber das war ja mein Ziel von Anfang an.
Sie leben seit vier Jahren in Berlin. Wie war das, als sie nach 20 Jahren hier ankamen? Ohne Deutschkenntnisse, ohne Geld, ohne Unterkunft?
Ich lebte – wie die anderen Geflüchteten auch – in einer Berliner Notunterkunft. Dort bekam ich sofort Hilfe, das war eigentlich ganz gut. Man half mir, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Ich habe sofort angefangen Deutsch zu lernen und dann auch meinen Hauptschulabschluss gemacht. Ich bin ja mit Ende zwanzig das erste Mal zur Schule gegangen, weil ich in Afghanistan nur die Koran-Schule besucht hatte und während der langen Flucht natürlich auch keine Schule besuchen konnte. Ich musste also ganz von vorn anfangen. Mein Asylantrag wurde leider abgelehnt. Aber mein Anwalt legte Widerspruch ein. Jetzt hoffe ich, dass es doch noch eine positive Entscheidung gibt, aber das Warten darauf macht mich ziemlich nervös.
Sie haben nicht nur den Hauptschulabschluss geschafft, sondern auch die Ausbildung zum Altenpflegehelfer. Ziemlich viel in so kurzer Zeit.
Ja, ich wollte einfach etwas tun. Und dann erfuhr ich, dass die Diakonie geflüchtete Menschen wie mich zu Altenpfleger-Helfern ausbildet. Das habe ich sofort wahrgenommen. Ich ging wieder zur Schule und hatte gleichzeitig eine Arbeitsstelle in der Altenpflege – in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz, wo ich immer noch arbeite. Inzwischen mache ich eine weitere Ausbildung zur Altenpflege-Fachkraft. Die dauert noch mal drei Jahre, aber ich habe gemerkt, dass dies ein wunderbarer Beruf ist. Er passt zu mir. Ich kann alten Menschen helfen, die sich selbst nicht mehr versorgen können. In meiner Heimat Afghanistan gibt es diesen Beruf gar nicht. Auch keine Pflegeheime für alte Menschen. Wer alt und krank ist, wird von der Familie versorgt, bis er stirbt. Hier in Deutschland leben alte Menschen oft in Heimen. Ich finde das schade.

Wie kommen Sie überhaupt zurecht in Berlin? Alles ist ja ziemlich anders als in den Ländern, die sie auf der Flucht nach Deutschland kennen gelernt haben?
Ja, wie geht es mir hier in Berlin ... ich werde das oft gefragt. In den vier Jahren, die ich jetzt in der Stadt lebe, habe ich die deutsche Sprache gelernt, meinen Hauptschulabschluss gemacht, ich habe eine Arbeit, die ich sehr gerne mache. Die alten Menschen in der Wohngemeinschaft sind sehr nett und ich lerne immer noch viel von ihnen. Anfang hatte ich einige Schwierigkeiten: Ich muss ja auch mal ihre Windeln wechseln, sie berühren. Aber das ist inzwischen normal. Manchmal verstehe ich ihre Fragen nicht 100-prozentig. Dann frage ich nach und es ist okay. Die acht alten Patientinnen, die hier in der WG leben, versuchen so gut es geht ihren Alltag noch selbst zu bestimmen. Dabei unterstützen sie meine Kolleginnen und ich.
„Richtige Freunde habe ich ich keine.“
Und sonst, in ihrem Privatleben? Sie haben eine eigene Wohnung, eine gute Arbeit. Haben sie auch Freunde gefunden in Berlin?
Nein, leider nicht. Richtige Freunde habe ich ich keine. Aber nette KollegInnen und auch Mitschüler, die mit mir zusammen die Ausbildung machen. Das Problem ist: Ich habe diese ständige Angst, dass ich vielleicht doch nicht in Deutschland bleiben darf. Das bestimmt zur Zeit mein Leben. Immer wieder werden ja Geflüchtete abgeschoben. Auch nach Afghanistan. Einige müssen Deutschland verlassen, selbst wenn sie eine Arbeit haben. Kein Mensch versteht, warum das so entschieden wird. Jeden Tag, wenn ich in meinen Briefkasten schaue, gibt es diese Angst: Ist da ein Brief von der Ausländerbehörde dabei, in dem meine Abschiebung angekündigt wird?
Wenn es wirklich dazu käme, welche Perspektive gäbe es für Sie in Afghanistan?
Eigentlich gar keine. Ich denke oft daran, was mich in Afghanistan erwarten würde. Wahrscheinlich wäre ich erst einmal obdachlos. Und meinen Beruf als Altenpfleger könnte ich dort nicht ausüben. Es gibt dort auch keine Familie, die mich auffangen würde. Ich denke oft an meine Brüder. Ich weiß nichts mehr von ihnen. Mein weiteres Leben ist sehr ungewiss.
Da fällt es Ihnen sicher schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken?
Ja. Wichtig ist jetzt vor allem, dass ich ein Bleiberecht erhalte und mein weiteres Leben hier in Berlin endlich eine Zukunft hat. Ich habe ja schon einiges geschafft und das will ich nicht alles aufgeben. Außerdem: Mir haben in den Jahren meiner langen Flucht viele Menschen immer wieder geholfen. Ich möchte jetzt auch anderen helfen: vor allem alten Menschen, die sich selbst nicht mehr helfen können. Auf all das hoffe ich.